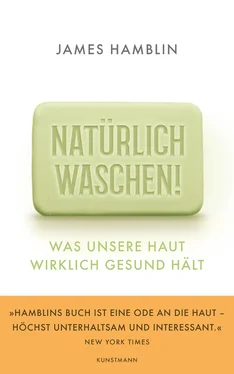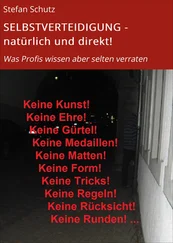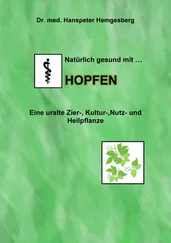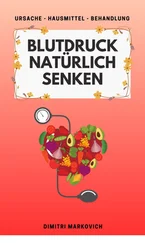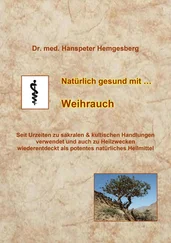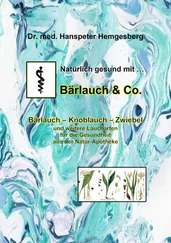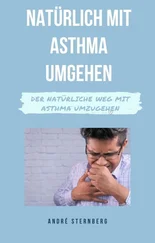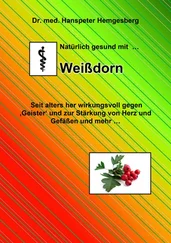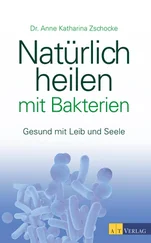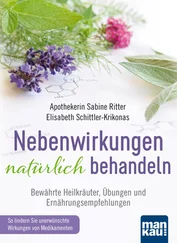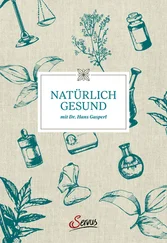»Ich frage die Leute: >Wie duschen Sie?<���«, sagt sie. Ihre Patienten, so Skotnicki, würden gern der Jahreszeit die Schuld geben, als könne die Haut nur im Sommer normal funktionieren. Doch dann erkundige sie sich nach den Waschgewohnheiten: »Die Männer schrubben den ganzen Körper mit irgendeinem >Männerduschgel<. Weil sie draußen arbeiten, duschen sie zweimal täglich. Aber wenn ich ihnen sage, dass sie damit aufhören sollen, und sie nur noch bestimmte Stellen waschen, geht es ihnen wieder gut.«
Ich frage nach den »bestimmten Stellen«.
»Achseln, Genitalbereich, Füße«, sagt sie. »Muss man sich, wenn man in der Dusche oder Wanne ist, hier«, sie zeigt auf den Unterarm, »auch waschen? Nein.«
Mit fast verzweifelter Stimme berichtet sie, wie oft sie den Männern erklären müsse, dass sie sich nicht vollständig mit Duschgel einschäumen sollen. Die Haut brauche Feuchtigkeit oft nur, weil sie schon zu lange zu häufig gewaschen wurde.
Und selbst Wasser allein habe Folgen für die Haut. Insbesondere warmes Wasser spüle die Fette ab, mit denen unsere Drüsen die Haut feucht halten. Alles, was die Haut trockener und poröser mache, erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Reizstoffe und Allergene reagiere.
Skotnicki ist überzeugt davon, dass zu häufiges Waschen die Haut schädigt und Menschen mit entsprechender genetischer Prädisposition dadurch häufiger Neurodermitis entwickeln. Doch Neurodermitis, die an sich schon nervenzehrend genug ist, kommt häufig nicht allein. Offenbar gehört sie zu einem Symptomkreis, der durch irrtümliche Immunreaktionen verursacht wird. Rund die Hälfte aller Kinder mit schwerer Neurodermitis entwickelt später, in einem sogenannten »Allergischen Marsch«, immunologische Überreaktionen wie allergischen Schnupfen oder Asthma.
Der Allergische Marsch mit den genannten Symptomen wurde von Allergolog*innen der Universitäten von Pennsylvania und Chicago erstmals 2003 beschrieben. Später wurde das Krankheitsbild noch erweitert. In neueren Studien wird sogar die immer häufigere Erdnussallergie dazugezählt. So zeigten sich Fachleute am King’s College London im Jahr 2010 »bestürzt« darüber, dass Babys mit Asthma eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch an einer Erdnussallergie zu leiden. Der Leiter des US-amerikanischen Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, riet Eltern 2019, »durch frühzeitigen Hautschutz Lebensmittelallergien bei ihren Kindern vorzubeugen«.
Wir wissen noch nicht genau, wieso eine gute Hautpflege vor Lebensmittelallergien schützt, doch laut neuerer Expertenempfehlungen kann ein früher Kontakt mit Erdnüssen, und nicht etwa das Vermeiden derselben, die Wahrscheinlichkeit verringern, eine schwere Erdnussallergie zu entwickeln. So wie das Immunsystem durch Impfungen lernt, Infektionskrankheiten zu bekämpfen, so könnte es durch kleine Erdnussmengen lernen, Erdnüsse zu tolerieren. Doch bis heute entscheidet man sich bei allergenen Hautreaktionen genau für die gegenteilige Strategie. Häufig werden sie mit Medikamenten behandelt, die die Immunreaktion unterdrücken, mit Antibiotika und natürlich mit regelmäßigen, aggressiven reinigenden und feuchtigkeitsspendenden Anwendungen.
Neurodermitis ist so weit verbreitet, dass sie gern als kleines Ärgernis betrachtet wird, was sie häufig auch ist. Doch manchen kann es dadurch richtig elend gehen. Eine Neurodermitis kann den Schlaf beeinträchtigen (nachts ist das Jucken am schlimmsten) und, wenn man sich stets kratzen muss, sogar die Existenz bedrohen. Hier kommt offenbar alles zusammen, was schlecht für die Haut ist: eine gestörte Schutzschicht, ein mikrobisches Ungleichgewicht und eine Vermehrung der Immunzellen. Wird die Schutzschicht der Haut durch Waschen oder Kratzen beeinträchtigt, kann sich die mikrobielle Besiedelung verändern und das Immunsystem dadurch hochgefahren werden. Den Hautzellen wird dann signalisiert, sich rasch zu vermehren und mit Entzündungseiweißen anzureichern. So entsteht ein sich selbst erhaltender Kreislauf aus Entzündung, Jucken, Zusammenbruch der Schutzschicht und mikrobiellem Ungleichgewicht. »Könnte es nicht sein«, spekuliert Skotnicki, »dass die Neurodermitis überhaupt erst durch das häufige Waschen in unserer Gesellschaft ausgelöst wird?«
Jedenfalls hat beides zur gleichen Zeit zugenommen, und es gibt Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang besteht. Doch anstatt die Haut wieder mehr Umgebungsreizen auszusetzen, verleiten uns Allergien und Überempfindlichkeiten dazu, uns noch intensiver zu säubern und unsere Umgebung noch steriler zu halten. Patient*innen, die zu Skotnicki kommen, leiden häufig seit Wochen oder Monaten unter Ausschlag, und sie würden sich am liebsten noch mehr schrubben und einseifen. Sie hoffen auf ein neues Produkt, das die bisher verwendeten ungeschehen machen oder wenigstens ausgleichen kann. Etwas »Mildes, Natürliches«. Etwas, was, na ja, eigentlich eher nichts sein soll.
Doch für Ärzt*innen ist es schwer, nichts zu verschreiben. Häufig wünschen sich die Patient*innen eine Behandlung, wenn schon kein Rezept, so doch zumindest etwas, was sie regelmäßig tun können. Skotnicki hat einen Weg gefunden, aus dem Nichts etwas zu machen. Sie empfiehlt eine radikale Produkt-»Diät« oder -»Bereinigung«, das heißt, mit allem aufzuhören. Oder mit möglichst allem. Selbst wenn die Probleme nicht durch bestimmte Produkte ausgelöst wurden, vertreten Dermatolog*innen zunehmend diesen Ansatz.
Es kann psychologisch hilfreich sein, zu erkennen, wie wenig wir eigentlich brauchen, und erst dann behutsam nur noch das zu verwenden, was wir wirklich wollen. Denn im Grunde ist unsere Haut sehr widerstandsfähig. Wir können versuchen, sie mit den aktuellsten Produkten zu regulieren oder zu kaschieren, aber auf die beständigen inneren und äußeren Signale reagiert sie so, wie sie es in Jahrmillionen gelernt hat. Sie will ihr Gleichgewicht wahren.
***
Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Würde man sie ausbreiten, wäre sie fast zwei Quadratmeter groß. Sie ist in alle Richtungen beweglich, dehnbar und registriert selbst winzigste Temperatur-, Druck- und Feuchtigkeitsschwankungen. Die Signale werden von Nervenenden in der Haut an unser Gehirn weitergeleitet, dank derer wir alles zwischen furchtbaren Schmerzen und ekstatischen Freuden empfinden können. Die Haut verrät es auch der Welt, wenn wir krank, müde, ängstlich oder erregt sind. Wenn sie aufreißt, kann sie in wenigen Tagen wieder verheilen. Sie schützt uns vor tödlicher Überhitzung, indem sie sich selbst in Flüssigkeit badet und so dafür sorgt, dass wir die Wärme schneller an die Umgebungsluft abgeben. Die Haut ist so lebenswichtig wie unser Herz, Rückgrat oder Gehirn. Ohne sie würde alles Flüssige, aus dem wir bestehen, verdunsten, die Außenwelt in uns eindringen, uns infizieren, und schon bald wären wir tot.
Die Haut ist also extrem wichtig. Doch Hautpflege heißt weit mehr, als sich mit irgendetwas einzuschmieren.
Zieht man die Lehrbücher zurate, erfährt man – wie auch ich an der medizinischen Hochschule –, dass die Haut aus drei anatomischen Schichten besteht. Die untere Schicht, die Unterhaut, setzt sich hauptsächlich aus Fett und Bindegewebe zusammen. Die beiden anderen Schichten sind allerdings interessanter. Die obere heißt Epidermis oder Oberhaut. Mit einem Millimeter ist sie ungefähr so dick wie ein Blatt Papier, aber in diesem Millimeter passiert überraschend viel. Die wichtigste Epidermiszelle heißt Keratinozyt und produziert das Faserprotein Keratin, aus dem unsere Haut überwiegend besteht, unsere Fingernägel und Haare sogar vollständig. Dazwischen sind zudem Immunzellen, winzige Nervenfasern sowie die Melanin produzierenden Zellen eingelagert, die der Haut ihre Farbe geben. Alle Hautzellen reagieren hochsensibel auf die Umgebung und können sich daran anpassen.
Читать дальше