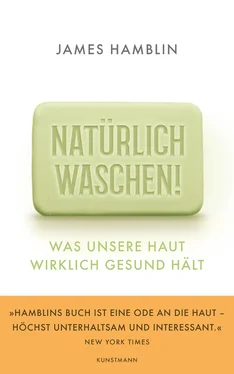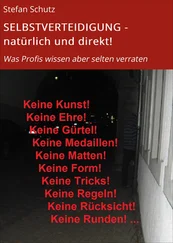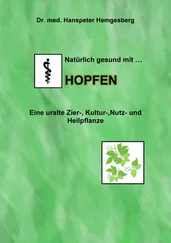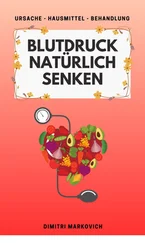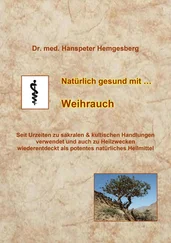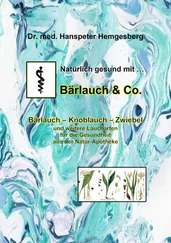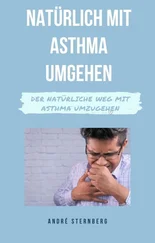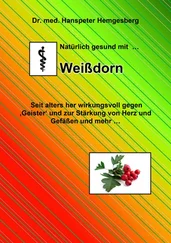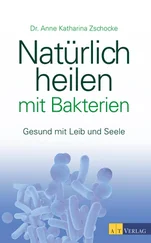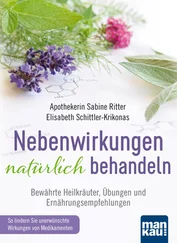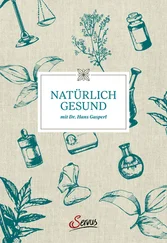Die angeblich krank machenden Dämpfe nannte man Miasma, im Fall der Pest Pesthauch. Auch wenn das ähnlich klingt wie unsere moderne Vorstellung von einer Ansteckung über die Luft, ging es beim Pesthauch um eine spirituelle Ansteckung. Die Pariser Ärzte warnten, dass »heiße, feuchte Körper für die Pestilenz am anfälligsten« seien, ebenso wie Körper »voll schlechter Stimmungen, weil unverbrauchte Abfallprodukte nicht richtig ausgestoßen« würden, oder Menschen »mit einem schlechten Lebensstil, zu viel körperlicher Ertüchtigung, Sex und Baden«. Die Vermeidung der furchtbaren Sünden garantierte zwar keine Gesundheit, versetzte aber die Bevölkerung garantiert in Panik: »Wer einen trockenen Körper hat, von Abfallprodukten geläutert ist, umsichtig Maß hält, wird der Seuche langsamer erliegen.«
Die Furcht vor heißem Wasser verbesserte die ohnehin entsetzliche hygienische Situation nicht gerade. Als man in Avignon keinen Platz mehr fand, um die Toten zu begraben, erklärte der Priester den Fluss kurzum zur geheiligten Erde. Reinen Gewissens hievten die Familien ihre Toten in die Rhône, doch die Gewässer waren weniger rein. Alle Menschen hatten Flöhe, die die Pestbakterien übertrugen, und bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts trat die Krankheit fast jedes Jahr irgendwo in Europa wieder auf. Die Badeanstalten schloss man von offizieller Seite aus Sorge vor Krankheitsübertragung. Panik und das mangelnde Wissen über das Pestbakterium, so die Journalistin Katherine Ashenburg, machten das 16. und 17. Jahrhundert zu den wohl schmutzigsten in der europäischen Geschichte.
Die vielen Todesfälle in den Städten ließen das Leben dort wenig verlockend erscheinen. Auf dem Land war es sicherer, dort gab es auch mehr Arbeit. Das änderte sich erst mit der industriellen Revolution. Bis ins 19. Jahrhundert lebten in den Städten jeweils nur wenige Hunderttausend Menschen. Es gab keine Hochhäuser oder Fabriken und folglich auch keine beständige Dunstglocke wie heute über Los Angeles, Hongkong oder Delhi.
In London wohnten erstmals 1801 über eine Million Menschen. Im Jahr 1850 waren es schon zwei Millionen, und weil die Menschen überall in die Städte strömten, bald ebenso in Paris und New York. Die Infrastruktur hielt mit dem Bevölkerungszuwachs allerdings nicht Schritt. Plötzlich war die Umwelt sichtbar dreckig. Die noch unasphaltierten Straßen waren im Sommer staubig, das restliche Jahr über matschig, immer voller Pferdeäpfel, und die Kohleöfen verpesteten die Luft. Die Gassen glichen Jauchegruben, die Brunnen waren vermüllt. Die ansteckenden Krankheiten, die sich unter diesen Bedingungen ausbreiteten, veränderten die Welt und ließen das öffentliche Gesundheitssystem entstehen.
Als in den europäischen Arbeiterbehausungen der 1840er-Jahre die Typhusepidemien grassierten, fiel dem deutschen Arzt Rudolf Virchow der Zusammenhang zwischen Lebensbedingungen und Krankheit auf. Seine Arbeit, die noch immer von der Miasma-Theorie geprägt war, brachte den amerikanischen Ärzteverband dazu, die Bedingungen in den USA zu untersuchen und schließlich 1847 Toilettenbelüftungen zu fordern, damit sich krankheitserregende Dämpfe verflüchtigen könnten.
Die These von der schlechten Luft wurde erstmals infrage gestellt, als der Arzt John Snow 1854 einen Cholera-Ausbruch in London zu einem Brunnen zurückverfolgen konnte. Mithilfe detaillierter Karten und der Befragung von Erkrankten versuchte er, gemeinsamen Gewohnheiten oder Aufenthaltsorten auf die Spur zu kommen. Die Methode, die Sherlock Holmes vorwegnahm, erwies sich als so bedeutsam, dass daraus schließlich die moderne Epidemiologie entstand. Doch Snow erkannte nicht den genauen Zusammenhang zwischen dem Wasser und der Krankheit. Ernst genommen wurde er auch nicht.
Dass das Wasser durch Organismen aus der menschlichen Fäkaliengrube direkt neben dem Brunnen verseucht war, lief damals nicht nur den gängigen Überzeugungen zuwider, sondern hätte auch erhebliche politische Folgen gehabt. In der gesamten Stadt hätte man menschliche Abfallprodukte und Trinkwasser trennen müssen. Die Londoner Regierung hielt Snows Entdeckung für reinen Zufall, für einen Zusammenhang gebe es keine Beweise. Erst als der deutsche Arzt Robert Koch 1883 Cholerabakterien unter dem Mikroskop sah, wurde Snow rehabilitiert, zwei Jahrzehnte nach seinem Tod. Diese Entdeckung, die epidemiologischen Hinweise aus dem Londoner Brunnen und spätere Beobachtungen erhärteten für Koch die Vermutung, dass das verseuchte Wasser die Ursache war. Und wenn die »Keime« unbemerkt in unser Trinkwasser kriechen und uns töten konnten, konnten sie wohl genauso gut für viele andere Krankheiten, Leiden und Temperamente verantwortlich sein.
Während die Gefahr von Infektionskrankheiten durch Verstädterung und rasches Bevölkerungswachstum zunahm, drang die neue »Keimtheorie« langsam ins öffentliche Bewusstsein. Um die Jahrhundertwende gehörten die Bekämpfung und Vorbeugung von Infektionskrankheiten schließlich zur Städteplanung. Diese »Hygiene-Revolution« war im Grunde das Resultat ihres industriellen Vorläufers. Um die erforderlichen Sanitär- und Hygienemaßnahmen durchzusetzen, baute man in Europa und den USA ein öffentliches Gesundheitswesen auf. Statt wie bisher die Keimtheorie zu leugnen, ging die Politik nun schleunigst dazu über, in präventive Infrastrukturmaßnahmen zu investieren. Im Fokus standen keimfreies Trinkwasser, Abwasserkanäle und die Volkserziehung zum Händewaschen nach dem Toilettengang, so wie es die Menschen in der übrigen Welt seit Jahrtausenden taten. Man hatte es bislang einfach hingenommen, dass die Bevölkerung ganzer Stadtviertel oder Städte plötzlich dahinschwand. Die Erkenntnis, dass sich das verhindern ließ, war revolutionär.
Damit rückte auch die Körperpflege ins Zentrum des öffentlichen Bewusstseins. Wie sauber jemand war, sagte nun etwas über sein Gefahrenpotenzial. Wer ungepflegt war, konnte sich das Waschen offenbar nicht leisten und nutzte den Graben in der Gasse vor dem Mietshaus als Toilette. Womöglich übertrug er oder sie auch Krankheiten. Wer gepflegt war, sauber gekleidet, sorgfältig gekämmt und mit frisch gewaschenem Gesicht, signalisierte Sicherheit. Obwohl ein gepflegtes Äußeres kein Garant dafür war, dass jemand sich die Hände wusch und keine Flöhe hatte – die gefürchtetsten Krankheitsüberträger –, gingen äußeres Erscheinungsbild und Hygiene nun Hand in Hand.
Sauberkeit und Schmutz wurden nun konkret mit Gesundheit beziehungsweise Tod assoziiert, und die dazu passenden polarisierenden Konnotationen verbreiteten sich zusehends. Doch ein saubereres Erscheinungsbild erforderte Zeit und Geld. Sichtbare Körperpflege wurde zum Statussymbol, und mehr galt oft als besser. Es reichte nun nicht mehr, nicht ekelerregend auszusehen oder zu riechen, man musste duften. Ein sauberes Äußeres wurde zur Voraussetzung für bestimmte Berufe und soziale Kreise. Die Arbeiterklasse galt als ungewaschen, und der soziale Aufstieg konnte nur dann gelingen, wenn man sich trotz Latrine vorm Haus passend für eine Arbeit fern der Latrinen kleiden konnte.
Die Mittel- und Oberklasse in Manhattan begann Anfang des 20. Jahrhunderts, sich im eigenen Schlafzimmer zu waschen. Selbst in ärmlichen Mietshäusern stellten die Familien samstags den Badebottich in die Küche, füllten ihn mit Wasser und wuschen ihre Kinder. Eimerweise trugen sie das Wasser über endlose Treppen und Flure nach oben und erhitzten es auf dem Holzofen. Ein »sauberes« Aussehen war – und ist es für einige bis heute – diese Mühen wert.
Die neuen Hygienevorstellungen wurden explizit als Werkzeug gesellschaftlicher Reformen eingesetzt. Aus den ersten Anstrengungen, sexuell übertragbare Krankheiten einzudämmen, entwickelte sich die Bewegung der »Sozialhygiene«. Im Ersten Weltkrieg versuchte man so, mit öffentlichen Aufklärungskampagnen der Syphilis Einhalt zu gebieten. Später wurden daraus Programme zur Sexualaufklärung im Klassenzimmer. Nun konnte man im Namen der Hygiene und mit wissenschaftlicher Rechtfertigung Themen ansprechen, die vorher mit einem unüberbrückbaren Tabu belegt waren.
Читать дальше