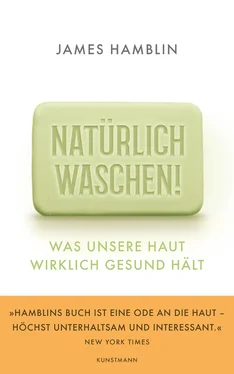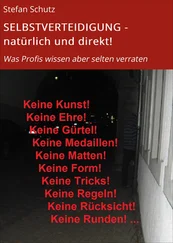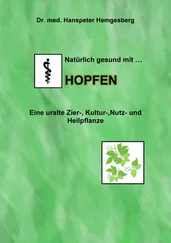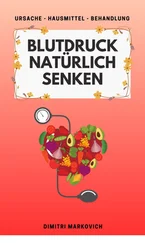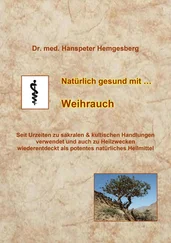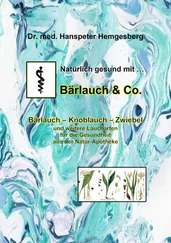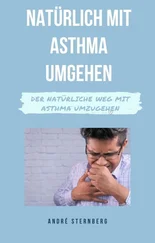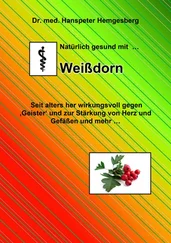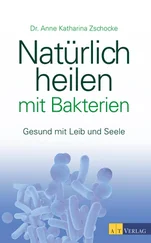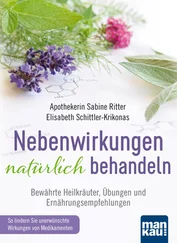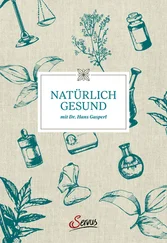Auch wenn die Biologie eine Weile gebraucht hat, bis sie damit warm wurde, die Schriftstellerin Toni Morrison hat es schon immer gewusst. In einem Interview von 1993 für den Paris Review sagte sie: »Man kann die Schönheit nicht ausblenden. Sie ist kein Privileg oder ein Luxus. Eigentlich muss man sich nicht einmal darum bemühen. Man kann sie fast mit dem menschlichen Streben nach Wissen vergleichen, der Mensch ist dafür gemacht.«
***
Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte hatte Körperpflege eher mit Spiritualität und Ritus zu tun als mit heutigen Gesundheits- oder Schönheitsvorstellungen. So schlugen die Azteken im 15. Jahrhundert riesige Wasserbecken für Reinigungsriten in den Bergfels. Wenn die Babys von den Hebammen gewaschen wurden, riefen sie die Wassergottheit Chalchiuhtlicue an:
Komme zu deiner Mutter Chalchiuhtlicue … Möge sie dich empfangen! Möge sie dich waschen! Möge sie allen Schmutz, der von deiner Mutter, deinem Vater auf dich gekommen ist, von dir nehmen und fortwerfen! Möge sie dein Herz reinigen! Möge sie es edel und gut machen! Möge sie dein Verhalten edel und gut machen!
Bei den Azteken wurden selbst die Sklav*innen, die man zur Opferung vorbereitete, mit heiligem Wasser gereinigt. Im alten Ägypten kleidete man die Toten wie Gottheiten und wusch sie nach einem bestimmten Ritual, damit sie leichter ins Jenseits gelangten.
Für den griechischen Arzt Hippokrates, auf den die Ärzte und Ärztinnen noch heute ihren Eid ablegen, war das Bad schon eher eine gesundheitsfördernde Maßnahme. Aber nie hätte er daran gedacht, Bakterien abzuwaschen. Bei der Vorstellung wäre er wie vom Blitz getroffen umgefallen. Er dachte eher an einen Wechsel aus kalten und heißen Bädern, um die Stimmungen auszugleichen. Bei Erkrankungen wie Kopfschmerzen und Harnverhalt hielt man damals warme Bäder für hilfreich, bei Gelenkschmerzen verschrieb man lieber kalte. Bäder waren in erster Linie dazu da, sich den Elementen auszusetzen, nicht so sehr, um bestimmte Krankheitserreger auszumerzen.
Ihren Höhepunkt fanden solche Vorstellungen in den berühmten Bädern des antiken Rom. In den öffentlichen Thermen trafen sich Bürger*innen aller Klassen zum Baden und geselligen Zeitvertreib. Oft befanden sich dort Sportanlagen unter freiem Himmel, umgeben von Räumen mit heißen ( caldarium ), lauwarmen ( tepidarium ) und kalten Bädern ( frigidarium ). In manchen Thermen gab es zudem Spieleräume, Bibliotheken, Speisen- und Getränkeverkäufer*innen und Prostituierte.
Manchmal rieben sich die alten Römer*innen mit Öl ein oder schabten Schmutz und Dreck mit einer Art Sichel ab. Doch wenn die Bäder einen hygienischen Nutzen hatten, dann höchstens zufällig. Die Wasserbecken waren alles andere als keimfrei. Wie zeitgenössische Berichte vermuten lassen, kam das Wasser aus öffentlichen Tiertränken. Gesunde und Kranke badeten zudem dicht an dicht. So empfahl der Philosoph Celsus bei unzähligen Beschwerden, etwa Darmentzündungen, kleinen Pusteln oder Durchfall, ein Bad zu nehmen. Da es keine Chloranlagen oder Umwälzpumpen gab, muss man davon ausgehen, dass auf dem Wasser ein schaumiger Schlier aus Dreck, Schweiß und Fett trieb.
Die Kombination aus Müßiggang und Nacktheit machte die Thermen zur Zielscheibe damaliger Kulturkämpfe. Dass sich die dekadenten Anlagen in seiner Heimatstadt verbreiteten, hielt der Philosoph Seneca für ein Zeichen des moralischen Niedergangs. Die christliche Frühkirche riet ebenso vom Baden ab.
Im Gegensatz dazu unterstrich die jüdische Gesetzgebung um die Zeit Jesu die Bedeutung körperlicher Reinheit durch den Erlass von Ernährungs- und Hygienevorschriften. Gemäß der Vorschriften musste man sich vor und nach dem Essen die Hände und vor dem Betreten des Tempels Hände und Füße waschen. Das Sprichwort »Cleanliness is next to godliness« (Reinlichkeit kommt gleich nach Frömmigkeit) leitet sich angeblich von einem Rabbinerausspruch ab, nach dem körperliche Reinheit die Voraussetzung spiritueller Reinheit sei.
Doch die Frühchrist*innen wandten sich gegen eine Moral aus Vorschriften und Verboten und ließen von den strengen jüdischen Regeln zu Lebensmitteln, Beschneidung und Sabbatgebot ab. Ihr Messias war in puncto ritueller Reinigung eher ein Minimalist. Die Maler*innen befreiten Jesus später von Schmutz und Filz, er selbst aber machte sich wie viele, die eine treue Gefolgschaft haben, ausdrücklich keine Gedanken um seine Schönheit. Laut Matthäus schalt er, wem religiöse Rituale wichtiger waren als innere Reinheit. »Reinige zum Ersten, was inwendig im Becher ist, auf dass auch das Auswendige rein werde!« Und an anderer Stelle im Neuen Testament heißt es, die Pharisäer seien schockiert gewesen, weil Jesus und seine Jünger Brot aßen, ohne sich zuvor die Hände zu waschen. Im 4. Jahrhundert schrieb schließlich Hieronymus, wer in Christus gebadet sei, müsse sich nicht waschen.
Unter den Weltreligionen ist das Christentum, das außer der symbolischen Taufe keine Wasch- oder Körperpflegevorschriften kennt, eher ein Außenseiter. Der Islam schreibt fünfmal täglich rituelle Waschungen vor dem Gebet vor. Wegen des hohen Wasserbedarfs an den Moscheen entwickelten die arabischen Städte daher im Gegensatz zu Europa raffinierte Wasserversorgungssysteme. Ein Muslim, der in den 920er-Jahren die Wolga bereiste, schrieb über die Wikinger: »Es sind die verdrecktesten Geschöpfe Allahs, sie waschen sich nicht nach dem Kacken und Pinkeln, nicht nach dem Geschlechtsverkehr oder dem Essen. Sie verhalten sich wie ungeratene Affen.«
Der Hinduismus kennt ebenfalls verbindliche Körperpflegerituale. Schon Jahrhunderte vor der westlichen Keimtheorie mahnte er, nach dem Toilettengang die Hände zu waschen. Nur die linke Hand war dafür erlaubt, die rechte ausschließlich fürs Essen. Als der Italiener Marco Polo im 13. Jahrhundert Indien bereiste, war er überrascht, wie pingelig die Leute beim Trinken waren. Jeder habe seine eigene Wasserflasche, staunte er, »niemand würde aus einer fremden Flasche trinken. Auch setzt keiner die Flasche an die Lippen.« Und noch verwunderlicher: Die Inder*innen badeten regelmäßig.
Auch in China vermerkte Marco Polo fasziniert: »Jeder nimmt mindestens dreimal in der Woche ein heißes Bad, und wenn er kann, im Winter sogar täglich. Wer etwas gilt oder wohlhabend ist, hat ein eigenes Bad im Haus.« Nicht so er selbst in Venedig. Als das alte Rom von den Völkern, die man später Barbaren taufte, unterworfen worden war, waren viele Aquädukte und Thermen zerstört worden. Die fehlende Infrastruktur und die Skepsis des Christentums gegenüber der Körperpflege machten das Mittelalter, wie man später sagte, zu »eintausend Jahren ohne Bad«.
Mitte des 14. Jahrhunderts spitzte sich die Lage zu. Die Europäer*innen litten plötzlich an schwarzen, eiternden Beulen, die, wie Giovanni Boccaccio im Dekameron schreibt, groß waren wie Eier oder Äpfel. Drei Tage nach den ersten Beulen starb der oder die Betroffene. Als »der schwarze Tod« in Boccaccios Heimatstadt Florenz wütete, sah er, wie Mütter die eigenen Kinder aussetzten, dem Leichengeruch sei nicht zu entkommen. Trotz der Gebete und Prozessionen breitete sich die Krankheit unkontrolliert aus. Innerhalb von drei Jahren war ein Drittel der europäischen Bevölkerung tot.
Die Beulen waren geschwollene, von Immunzellen überschwemmte Lymphknoten. Durch die Pestbakterien lief die Immunabwehr aus dem Ruder. Doch das wusste man erst fünfhundert Jahre später. Die Christ*innen beschuldigten also die Juden und Jüdinnen, Gift in den Städten zu versprühen. Vor die Wahl gestellt, lebendig verbrannt oder christlich getauft zu werden, gestanden manche jüdischen Gefangenen ihre Schuld und wurden von ihren angeblichen Sünden freigesprochen. Manchen half selbst das nicht.
Eine etwas gelehrtere Erklärung sah den Stand der Gestirne als Ursache des Problems. Laut einem Bericht der medizinischen Fakultät der Pariser Universität von 1348 starben die Menschen, weil Saturn und Jupiter unglückseligerweise mit Mars, »einem bösen Planeten, der Zorn und Kriege begünstigt«, in einer Reihe standen. Da der Mars rückläufig gewesen sei, hätte »er viele Dämpfe von der Erde und den Meeren angezogen, die sich mit Luft vermischten und deren Substanz beschädigten«.
Читать дальше