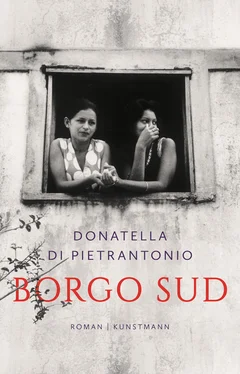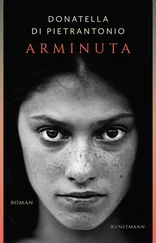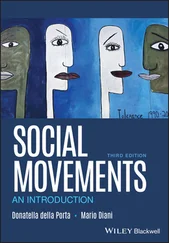Mit automatischen Bewegungen nahm Adriana die getrocknete Wäsche von der Leine auf dem Balkon ab, begann sie zu falten und legte sie auf einen Stuhl. Sie trat zur Seite, als unsere Mutter beladen mit zum Einfrieren bereiten, in Beutel abgepackten Peperoni hereintrat. Einige hatte sie auf einer Platte für das Mittagessen bereitgelegt, ein verschnürtes Päckchen fand ich später in meiner Handtasche, für Piero, der diese Peperoni so gern mochte. Sie breitete die karierte Decke über den Tisch und stellte vier Teller darauf. Mit einem Nicken zur Besteckschublade befahl sie mir weiterzumachen. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie sie zwischen den beiden Zimmern hin- und herging, noch mehr Kissen brachte für die Sicherheitsschranke rund um Vincenzos Schlaf. Dann kehrte sie in die Küche zurück, würzte rasch die Peperoni: Öl und Salz, Knoblauch und gehackte Petersilie.
»Nimm den Hut runter und schneide Brot auf«, sagte sie zu Adriana, ohne sich umzudrehen.
Meine Schwester gehorchte, ihr wenige Millimeter langes Haar wurde ignoriert. Stumm setzten wir uns an die vier Seiten des Tisches, nur das Stühlerücken war zu hören. Auch im Sitzen schwitzte man.
»Gibt’s keinen Wein oder habt ihr ihn vergessen?«, fragte unser Vater irgendwann.
Ich erhob mich, hinter dem Vorhang unter dem Spülbecken fand sich noch ein Rest in einer Flasche. Ich goss ihm den Rotwein ins Glas, danach war keiner mehr übrig. Er trank ihn und schnalzte mit der Zunge, während er Adriana am anderen Kopfende des Tisches betrachtete, die mit dem Brot das schmackhafte Öl auftunkte.
»Wie hast du deinen Sohn genannt?«
»Vincenzo.«
Unsere Mutter hielt sich die Hand vor den Mund und stand auf. Sie machte ein paar Schritte Richtung Schlafzimmer, dann muss ihr eingefallen sein, dass dort ja das Kind lag. Sie schloss sich im Zimmer der Jungen ein.
»Ist der Vater schon über alle Berge?«, fing er in der darauffolgenden Stille wieder an.
Vom Platz tönten Stimmen herauf, ein lautes Lachen. Ohne Adriana, die nicht antwortete, aus dem Auge zu lassen, schob er den leeren Teller von sich weg.
»Und wie ziehst du ihn jetzt groß?«, beharrte er.
Sie richtete sich auf, legte die Brotrinde, die sie in der Hand hielt, auf die blau karierte Tischdecke.
»Besser als du mich großgezogen hast, wetten?«
Als das Kind erwachte, brachen wir sofort auf. Beim Starten sah ich unsere Mutter im Rückspiegel. Hätte ich sie nicht aufgefordert einzusteigen, wäre sie zu Fuß losgegangen wie immer, zwei Kilometer hin und zwei zurück, oder jemand aus dem Dorf hätte sie mitgenommen. Am Friedhof stieg sie wortlos aus. Es war das letzte Mal, dass Adriana sie sah. Ihre ungewöhnliche Intuition ließ sie im Stich, sie erkannte kein warnendes Zeichen in der gebeugten Gestalt, die zwischen den Zypressen den Kiesweg hinaufschritt. So haben sie den Groll nicht beseitigt, haben sich nicht verabschiedet und nicht mehr in Frieden umarmt.
Adriana war zu weit vom Tod entfernt, um ihn vorauszuahnen, und wie alle jungen Menschen vertraute sie auf die Unsterblichkeit der Eltern.
Am nächsten Tag musste ich sie im Auto »wohin« bringen. Wir fuhren am rechten Flussufer entlang, als sie sagte, ich solle anhalten. Wir gingen zu Fuß weiter, Adriana immer etwas vorneweg, kerzengerade und auf den Weg konzentriert. Kleine salzige Wellen schwappten von der Mündung stromaufwärts, irritierten meine Augen.
»Hätten wir nicht später kommen können, wenn es kühler ist?«, fragte ich.
»Manche Sachen muss man in der Mittagshitze machen«, erwiderte meine Schwester und wandte sich Richtung Borgo Sud.
Gewiss litt auch sie unter ihrem Strohhut und der Sonnenbrille, die sie sich ohne zu fragen bei mir geborgt hatte. Wir wagten uns zwischen die Sozialwohnungsblocks und die ein- bis zweistöckigen Häuser. Ich war noch nie in diesem Viertel gewesen, wusste aber, dass Adriana seit Jahren hier verkehrte.
Die Stadt erstaunte mich, sie entpuppte sich als größer und verschieden von dem Plan in meinem Kopf, der sich aufs Zentrum und wenige Vororte beschränkte. Einige Hauswände waren mit naiven Motiven bemalt, ich blieb einen Moment stehen, um das Bild eines muskulösen Seemanns zu betrachten, der sein Boot aufs Trockene zog, im Hintergrund Segel im Wind.
Auf der Straße war niemand unterwegs, weder zu Fuß noch im Auto, die Fensterläden waren geschlossen, die Lieferwagen der Fischhändler parkten am Gehsteigrand. Das Viertel wirkte wie ein geschlossener Raum, in dem die Zeit langsamer verging und andere Regeln herrschten. Eine unsichtbare Grenze schottete ihn von Pescara rundherum ab. Aber es war sauber, nicht ein weggeworfenes Stück Papier auf dem Boden.
Adriana bemerkte, dass ich zurückgeblieben war, trat zu mir und zog mich am Arm.
»Das ist kein Ausflug, beeil dich«, knurrte sie zwischen den Zähnen. »Die, die nicht draußen auf dem Meer sind, schlafen nach dem Mittagessen«, fügte sie leise hinzu, als könnten wir jemanden wecken.
Aber auf einem schattigen Balkon im ersten Stock saß doch jemand und aß mit nacktem Oberkörper eine Wassermelone. Als er uns sah, hielt er mit dem Stück in der Luft inne. Er spuckte Kerne aus. Unter seinem Blick bewegte Adriana sich ruckartig, ein Zeichen dafür, dass sie Angst hatte. Irgendwann machte sie plötzlich kehrt, ich folgte ihr in den Schutz eines Wohnblocks. Hinter uns hörte man Geschrei, es konnte von dem Mann stammen.
Eine Weile liefen wir mit schnellen Schritten herum, aber irgendwie ziellos. Schließlich, nachdem sie sich mehrmals umgeblickt hatte, führte sie mich zur Rückseite eines grünen Hauses. Zuerst lauschten wir all dem Schweigen, dann schob sie ihren Arm durch die Stäbe eines Gittertors und fand tastend den Schlüssel, um es zu öffnen, so als sei sie diese Geste gewohnt.
»Was machst du da, wohin gehen wir?«, protestierte ich halblaut.
»Ich hab dir ja gesagt, dass ich mir ein paar Sachen holen muss, es dauert nicht lang.«
Sie zog mich hinein in etwas, das kein Hof, keine Veranda und auch kein Garten war, aber noch sichtbare Spuren eines Familienlebens aufwies. Auf einer Seite kümmerten neben einem Liegestuhl und einem geschlossenen Sonnenschirm ein paar Pflanzen in der ausgetrockneten Erde vor sich hin. Der übrige Platz war mit einem gewellten Vordach geschützt: darunter eine Arbeitsplatte mit Gaskocher und Spülbecken, ein Tisch mit Plastikdecke und lauter verschiedenen Stühlen. In einer Ecke gelbe Fischerstiefel und zusammengeknüllte Netze, die vielleicht geflickt werden sollten. Der Schirokko der letzten Tage hatte alles mit einem Sandschleier bedeckt. Die Fenstertür stand offen und die Scheibe war zerbrochen, die Splitter knirschten unter Adrianas Schritten.
»Warte hier auf mich, und falls du was Verdächtiges hörst, pfeif«, sagte sie auf der Schwelle.
Sie ließ mir keine Zeit, sie daran zu erinnern, dass ich nicht pfeifen konnte. Sie durchquerte ein Zimmer und noch eins, dann hörte ich sie die Treppe hinaufsteigen. Vorsichtig, die Ohren gespitzt beim geringsten Geräusch, aber auch mit der Selbstverständlichkeit von jemandem, der in diesem Haus gewohnt hat. Ich wollte nicht ohne sie draußen herumstehen und trat ins Halbdunkel einer Küche, nur dass auf einer Seite ein schmales Bett stand und am Fußende die Wiege, in der Vincenzo geschlafen hatte. An den zerwühlten Laken erkannte ich meine Schwester, die plötzlich aufgewacht war und sie weggeschleudert hatte.
Die Einrichtung war schlicht, aber gepflegt in allen Einzelheiten. Auf einem Wandbord lag eine Sammlung Muscheln, nach Größen geordnet, die goldenen Spiralen ins Licht gerückt. Auf dem Fernseher einige Bücher: Hundert Fischrezepte stand auf den Buchrücken, Das Meer auf dem Tisch .
Überall erkannte ich Adrianas Hand, aber meine Fremdheit dem gegenüber, was sie hier geschaffen hatte, erschütterte mich.
Читать дальше