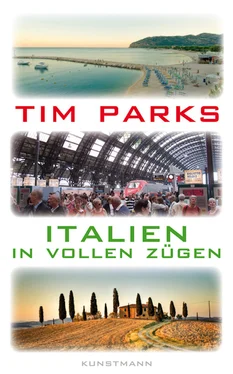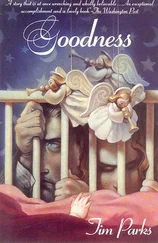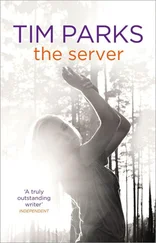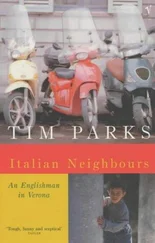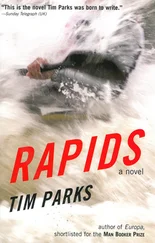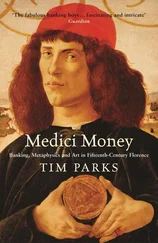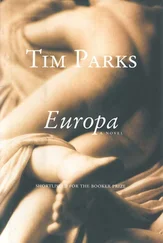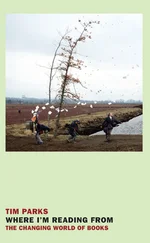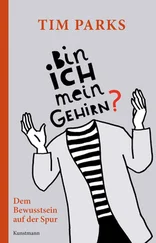Das ist etwas, das ich in England noch nie erlebt habe. Dort sind in Pendlerzügen die meisten Reisenden in sich selbst vertieft, in eine Zeitung oder ein Buch, oder versuchen, die Träume von vor einer Stunde weiterzuspinnen. Die Fahrt ist von einer wohltuend melancholischen Stimmung geprägt. Nicht so im Interregionale nach Mailand. Hier sind die Toten quicklebendig, was wesentlich unangenehmer ist. Entweder sind die Fahrgäste in Brescia Nachbarn oder in Mailand Arbeitskollegen. Überall im Wagen bilden sich angeregt plaudernde Grüppchen. Einige der Grüppchen kennen andere Grüppchen und verbandeln und verknüpfen sich mit ihnen. Ein paar Studenten tauschen Seminaraufzeichnungen aus. Über Fußball, Politik und das beste Rezept für Spargelrisotto wird eifrig diskutiert. Ich schiebe mir ein paar gelbe Schaumstoffstöpsel in die Ohren.
Aber das reicht nicht. Um mich herum drängt sich ein halbes Dutzend Männer und Frauen Anfang dreißig. Normalerweise redet hauptsächlich einer, während die anderen gelegentlich Zustimmung äußern oder Einwände einstreuen. Bei geschlechtergemischten Gruppen ist der Redner unweigerlich ein Mann. »Juve wurde mal wieder ein klarer Elfmeter erlassen.« Juve oder Juventus ist eine der sogenannten Big-Four-Fußballteams – Juventus Turin, Inter Mailand, AC Mailand und Rom –, die immer die Meisterschaft gewinnen. »Habt ihr das gesehen? Una vergogna «, sagt ein Anzugträger, etwa Mitte dreißig, mit einer nasalen Stimme, dem frisch geschrubbten Gesicht eines Bankangestellten, einem Ohrring, einem spöttischen Grinsen und einer hellroten Krawatte. Er lacht beim Sprechen und macht in einer Tour Witze. Die Frauen schauen sich an und lächeln nachsichtig. Zwei von ihnen stehen Arm in Arm da, berühren einander. Diese Grüppchen strahlen ein merkwürdiges kollektives Bewusstsein aus, etwas sehr Körperliches. Diese Menschen mögen ihre Körper, sie mögen ihre Accessoires, ihre Handtaschen und Laptops und Handys und die winzigen Designer-Rucksäcke. »Schau, was ich mir gekauft habe. Hier, schau mal.« Sie befingern den neuen Stoff und berühren den Arm ihrer Freundin.
»Witz«, fängt die rote Krawatte lautstark an. »Hört zu. Also, Berlusconis Sohn fragt seinen papá um Rat, wie er ein Mädchen flachlegen kann, auf das er scharf ist, okay? Der alte Berlusconi sagt: ›Stefano, zuerst kaufst du ihr eine Diamantkette, va bene ? Dann lädst du sie in ein teures Restaurant ein, buchst ein Zimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel, sorgst dafür, dass eine Flasche eisgekühlter Champagner vom Feinsten auf dem Nachttisch steht – und schon gehört sie dir. Also nichts wie ran!‹ ›Aber Papà ‹, protestiert der Sohn, ›sollte die Liebe nicht umsonst und frei sein? Ich möchte nicht, dass sie denkt, ich will sie kaufen.‹ Und was gibt Silvio zur Antwort?« Vor der Pointe lächelt der Mann strahlend; er findet sich toll. »Was sagt der gute Silvio? ›Freie Liebe?‹, sagt er. ›Romantiker! Das war doch bloß etwas, das sich diese Geizhälse von Kommunisten ausgedacht haben, damit sie umsonst ficken konnten! ‹ Damit sie umsonst ficken konnten!«
Die anderen kichern und stöhnen. Jemandem fällt ein, was der Moderator einer Talkshow am Abend zuvor über die Auswahl der Schiedsrichter für die Serie A gesagt hatte. Ich finde mich damit ab, eine Stunde lang zum Zuhören verdonnert zu sein, immerhin mit dem angenehmen Dämpfungseffekt der Ohrstöpsel.
Vor Kurzem wurde bei Trenitalia, angeregt von weiß Gott was für einem hypersensiblen Fahrgast, über die mögliche Einführung eines »Ruhewaggons« für diejenigen gesprochen, die sich nicht unterhalten wollen. Ehe sie dieses revolutionäre Vorhaben jedoch in die Tat umsetzten, wurde beschlossen, zunächst eine Umfrage unter den Reisenden durchzuführen. Die Zeitungen veröffentlichten ein paar der Antworten. Am faszinierendsten waren die Reaktionen derjenigen, die gar nicht verstanden, worum es ging: »Wenn ich nicht will, dass ein Mann mich anspricht«, sagte eine Frau, »dann weiß ich schon, wie ich ihm erkläre, dass er mich in Ruhe lassen soll.« »Man kann doch selbst entscheiden, ob man reden will oder nicht«, stellte ein Student fest. Diese Leute kamen einfach gar nicht auf den Gedanken, dass manche von uns vielleicht in aller Ruhe lesen wollen. »Und was ist, wenn ich im Ruhewaggon sitze und mein Telefon klingelt?«, wandte jemand ein. Mit dieser schlichten Beobachtung hatte er seiner Ansicht nach die Absurdität des Vorhabens nachgewiesen. Man hat nie wieder davon gehört.
DER WICHTIGE PLATZ, den die Eisenbahn in der Psyche der Italiener einnimmt, zeigt sich in der Häufigkeit, mit der sie zur Zielscheibe politischer oder wirtschaftlicher Proteste wird. Ich weiß noch, wie ich einmal in den späten 1990er-Jahren auf der Fahrt nach Mailand – wie immer in Gesellschaft der lebenden Toten – von meinem Buch hochschaute und feststellte, dass der Zug stand. Es war ein außerplanmäßiger Halt; wir standen auf offener Strecke, inmitten einer Landschaft von Feldern, Pappeln und Masten. Jemand riss ein Fenster auf, und wir hörten hupende Autos und merkwürdige Hintergrundgeräusche, die klangen wie das Blöken von Rindern. Ich stand auf und schob mein Fenster herunter. Es war das Blöken von Rindern. Eine Gruppe von Bauern hatte ein Feld mit Traktoren vollgestellt und ein paar Kühe auf die Schienen getrieben, um die Züge zu stoppen. Mit Bannern protestierten sie gegen die EU-Quoten für Milcherzeugnisse.
Die Zeit verging. Aus dem Fenster gelehnt sah ich, dass ein Fernsehteam eingetroffen war. Es waren auch Polizisten da, die mit den Bauern zu plaudern schienen. Weiter vorne im Zug schob jemand knallend ein Fenster herunter und brüllte Beleidigungen und Flüche nach draußen. » Comunisti! Fannulloni ! (Faulpelze) Pagliacci ! (Witzfiguren) Merde! « Die Bauern brüllten zurück. Es wurden so ähnliche Gesten ausgetauscht wie zwischen rivalisierenden Fußballfans im Stadion: Hohn und Verachtung.
Als der Schaffner vorbeikam, fragte ich ihn, warum die Polizei die Strecke nicht räumte. Mit schiefem Lächeln erklärte er mir, dass zwischen der Eisenbahngewerkschaft, den Bauern und der Polizei eine friedliche Übereinkunft bestand, nach der die Bauern jeden Zug eine halbe Stunde lang aufhalten durften. Dann würden sie ihn weiterfahren lassen und den nächsten Zug anhalten. »Es wäre gefährlich«, erläuterte er, »eine Kuh auf die Schienen zu stellen, wenn der Lokführer nicht weiß, wo und wann er mit ihr zu rechnen hat. Das Tier könnte dabei umkommen.«
Wir hatten es also mit dem klassischen italienischen Kompromiss zu tun, einem gespielten Konflikt, bei dem sich eigentlich alle einig waren. Anarchie ist in Italien selten, aber die Legalität wird immer wieder zur Disposition gestellt, vor allem wenn man sich als jemand präsentieren kann, der ungerecht behandelt wurde, etwas, wozu sich die Bauern besonders berufen fühlen. Für jeden Liter Milch garantiert die EU den europäischen Bauern etwa den doppelten Weltmarktpreis; als Gegenleistung müssen die Bauern bestimmte Produktionsgrenzen einhalten und dürfen die hohen Preise nicht durch Überproduktion ausnutzen. Die Bauern in Norditalien hatten ihre Milchquoten weit überschritten, weigerten sich aber, die entsprechenden Strafen zu zahlen. Um die italienische Regierung zu ermutigen, in ihrem Interesse zu verhandeln, schien es ihnen eine gute Idee, die Züge aufzuhalten, die durch ihre Felder fahren.
In den nächsten sechs Wochen wurde es zur Gewohnheit, dass der Zug irgendwo mitten auf dem Land anhielt, der Lokführer mit den Bauern plauderte und die Kühe die Fahrgäste anmuhten. Die Protestierenden schlugen große Zelte auf, saßen an Campingtischen und tranken Wein aus großen Flaschen, während sie zuschauten, wie wir in unserem Interregionale oder Intercity gefangen waren. Manchmal konnte man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass Lokführer, Polizisten und Fernsehteams die Situation genossen. Jeden Abend wurde im Fernsehen unsere Lage dramatisiert und vom wirtschaftlichen Schaden gesprochen, während man weiterhin mit den Bauern, den vermeintlichen Opfern undurchsichtiger europäischer Regularien, sympathisierte. Schließlich gab die Regierung wie immer klein bei, wandte sich an Brüssel und erkämpfte dort, was die Bauern haben wollten. Was sie im Gegenzug versprochen haben, weiß ich nicht mehr, aber ich bezweifle ernsthaft, dass sie es gehalten haben. Italien ist das enthusiastischste Mitglied der EU und zugleich das Land, das am häufigsten vom europäischen Gerichtshof wegen Nichteinhaltung europäischer Vorschriften verurteilt wird. Das ist kein Widerspruch. Während der Protestaktionen hatten sich die Fahrgäste so an die Situation gewöhnt, dass sie die halbe Stunde Milchquoten-Verspätung schon in ihre Reiseplanung mit einbezogen.
Читать дальше