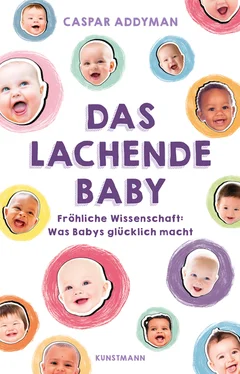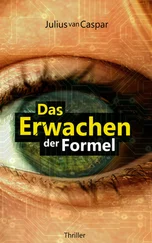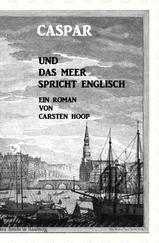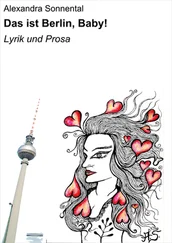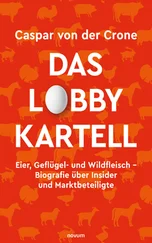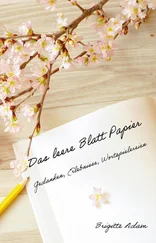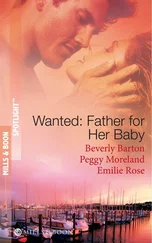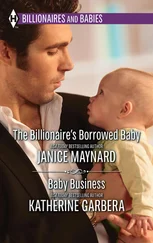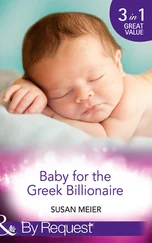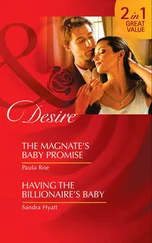1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Immer wieder werden die Leser in diesem Buch auf die »Nature-Nurture-Debatte« stoßen, auf den Gedanken, dass manche Fähigkeiten angeboren ( nature ) und andere erlernt sind ( nurture ). Jeder, der sich mit Entwicklungspsychologie beschäftigt, erkennt an, dass beides eine Rolle spielt, aber dennoch gibt es eine Kluft zwischen denen, die meinen, die Gene seien für das meiste verantwortlich, und den anderen, die den größten Anteil beim Lernen sehen. Die Arbeit von Johnson und Morton war wichtig als Beleg dafür, dass wir immer von »Natur plus Lernen« sprechen sollten.
Was die Fähigkeit von Neugeborenen angeht, Gesichtern zu folgen, hat die Natur zwei Gehirnsysteme ausgewählt: einen Kreislauf tief im Innern des Gehirns, der sich rasch auf Muster ausrichtet, die Gesichtern ähneln, und den allgemeineren, höherrangigen Kortex, der aus allem lernt, was er zu sehen bekommt. Dieses Lernen ist nurture . Weil Babys viele Gesichter sehen, werden sie Experten für Gesichter. Sie lernen, Personen zu unterscheiden und männliche Gesichter von weiblichen. Weil sie ihre Eltern häufiger sehen als alle anderen, erkennen sie sie am schnellsten. Dabei spielen Gene, Umwelt und Verhalten zusammen. Johnson und Morton legten mit ihrer Theorie eine mechanistische Darstellung dieses Zusammenspiels vor. Johnson nennt den Prozess »interaktive Spezialisierung« und entwickelte die Theorie zusammen mit Kollegen in einem sehr einflussreichen Buch mit dem Titel Rethinking Innateness weiter (Elman u. a. 1996).
Dieses Experiment war auch direkt dafür verantwortlich, dass ich mich der Babywissenschaft verschrieb. Aufgrund dieser Forschungen stellte die Birkbeck University in London Mark Johnson 1998 als Professor an und schlug ihm vor, das Centre for Brain and Cognitive Development zu gründen, auch bekannt als Birkbeck Babylab. Als einen der ersten Mitarbeiter rekrutierte er meinen Doktorvater Denis Mareschal, dessen Anfängervorlesungen über die kindliche Entwicklung mich auf das Forschungsgebiet gelockt hatten. Auf Mareschals Empfehlung hin las ich Rethinking Innateness, und von da an wollte ich auch Babyforscher werden.
Ein Witz auf Kosten der Wissenschaftler
In meiner liebsten Studie aus der Zeit, als ich mit meiner Doktorarbeit beschäftigt war, wurde eine ähnliche frühe Fähigkeit von Neugeborenen untersucht. 1977 veröffentlichten Andrew Meltzoff und Keith Moore (Meltzoff und Moore 1977) einen bemerkenswerten kurzen Artikel, in dem es darum ging, dass Neugeborene kleine Witzbolde sind. Ihr Artikel enthielt eine wunderbare Bilderserie, die den Kern des Experiments zum Ausdruck brachte. Die erste Reihe zeigte drei Bilder von Meltzoff, wie er die Zunge herausstreckte, den Mund weit öffnete und die Lippen zurückzog. In der Reihe darunter waren drei Bilder von drei sehr kleinen Kindern zu sehen, die ihn nachahmten. Die Kinder waren zwischen 14 und 17 Tage alt, und alle schienen ein Blitzen in den Augen zu haben. Ich hatte das Bild lange als Hintergrundbild auf meinem Computer. Ein Blick darauf hob unweigerlich meine Laune. Leider hat die Studie den Test der Zeit nicht gut bestanden.
Es schien, als wären Meltzoff und Moore über Johnson und Morton hinausgegangen und hätten gezeigt, dass Babys noch viel erstaunlichere Dinge tun, als ihre Köpfe einem Gesicht zuzuwenden. Die Babys von Meltzoff und Moore ahmten einen Erwachsenen nach. Sie konnten Gesichtsausdrücke imitieren, ohne jemals ihr eigenes Gesicht gesehen zu haben und lange bevor sie aus positivem Feedback etwas gelernt haben konnten. Die ursprüngliche Studie setzte auch ungewöhnliche Gesten mit der Hand ein. Die Babys schienen die Gesten zu imitieren wie kleine Möchtegern-Rapper, die Gang-Symbole zeigen.
Die Ergebnisse waren immer umstritten, weil es um sehr viel mehr ging als nur darum, Gesichter zu erkennen. Die Fähigkeit, auf diese Weise nachzuahmen, erfordert nicht nur einen einfachen Schaltkreis für die Gesichtserkennung, sondern einen Gehirnbereich, der in der Lage ist, mehrere Gesichtsausdrücke oder Gesten zu identifizieren. Und all das müsste dann in den Genen verankert sein. Verschiedene Erklärungen in dieser Richtung wurden vorgetragen, zum Beispiel wurde auf »Spiegelneuronen« verwiesen oder auf ein spezielles Gehirnmodul für soziale Imitation.
Einige Experimente schienen die Ergebnisse zu bestätigen, darunter eines mit neugeborenen Schimpansen. Andere konnten die Effekte nicht reproduzieren. Eine aktuelle Übersicht über alle veröffentlichten Studien zu dem Thema (Oostenbroek, Slaughter, Nielsen und Suddendorf 2013) kam zu dem Schluss, dass sich nur das Herausstrecken der Zunge konstant reproduzieren ließ. Das muss keine Nachahmung sein; möglicherweise strecken Babys ihre Zunge heraus, wenn sie aufgeregt sind, oder es ist einfach ein Reflex, der verschwindet, wenn sie älter werden. Die letzte Erklärung erscheint am ökonomischsten.
Neugeborene haben eine Reihe von einfachen Reflexen. Wir haben bereits über den Suchreflex oder Breast-Crawl -Reflex gesprochen, durch den sie die Brustwarze für ihre erste Mahlzeit finden. Sie haben auch einen Schreitreflex. Wenn man ein Neugeborenes über eine ebene Unterlage hält, machen die Füßchen ein paar winzige Schritte, die an Gehen erinnern. Und sie haben einen Greifreflex. Sie packen zu und lassen nicht mehr los. Dass ein Neugeborenes in der Lage ist, sich an Mamas Fell festzuklammern, ist für Primaten lebenswichtig, damit sie nicht vom Baum fallen. Alle Affenarten können das, und bei Menschenbabys hat sich dieser Reflex erhalten. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, dass ich in Denis Mareschals Kurs im Grundstudium gelernt habe, man könne ein Neugeborenes an der Wäscheleine baumeln lassen, so fest sei sein Griff. Ich habe allerdings noch nie jemanden kennengelernt, der das ausprobiert hat, und ich empfehle es auch nicht. Wenn Babys das Gefühl haben zu fallen, breiten sie die Arme aus und ziehen sie dann wieder eng heran. Damit vermindern sie erst die Gefahr, zu stürzen, und dann sorgen sie dafür, dass sie besser zupacken können. Dieser sogenannte Moro-Reflex, der Menschenbabys nichts nützt, ist ein angeborenes Überbleibsel aus unserer Primatenvergangenheit.
Im Anschluss an ihre kritische Übersicht beschlossen Oosten broek und Kollegen, eine endgültige Studie zu kindlicher Nachahmung durchzuführen, um zu überprüfen, ob es sich ebenfalls um einen Reflex handelte. Sie zeigten Neugeborenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen einer und neun Wochen nach der Geburt elf verschiedene Gesten (Oostenbroek u. a. 2016). Dazu gehörten das Öffnen des Mundes, das Herausstrecken der Zunge, glückliche und traurige Gesichter, einige Fingerbewegungen und ein paar einfache Töne. Die Babys imitierten keine davon. Mit gleich hoher Wahrscheinlichkeit zeigten sie die entsprechenden Gesten oder nicht. Die Forscher stellten fest, dass das Herausstrecken der Zunge, das Öffnen des Mundes, glückliche Gesichtsausdrücke (Lächeln) und »mmm«-Laute häufig vorkamen. Die Analyse zeigte, dass die Muster früherer Experimente reproduziert werden konnten, wenn nicht alle mög lichen Alternativen eingeschlossen wurden. Aber das ist kein Hinweis auf Nachahmung. Zum Beispiel konnte man die Babys am besten zum Lächeln bringen, indem man »mmm«-Laute vormachte, und nicht, indem man sie anlächelte.
Das Hauptargument, warum eine so frühe Fähigkeit zur Nachahmung vielleicht doch nicht existierte, war wohl, dass ein starker Effekt beim Lächeln ausblieb. Wenn Sie Mutter Natur wären und entscheiden müssten, welche gewinnenden Nachahmungseffekte ein neugeborenes Baby zeigen sollte, worauf würde Ihre Wahl wohl fallen? Mit einem Lächeln würden Babys vom ersten Tag an Freunde finden und Menschen für sich einnehmen. Aber die Studien förderten das nicht zutage. Sehr bald nach der Geburt lächelten die Babys und streckten ihre Zungen heraus, jedoch nicht als Reaktion darauf, dass jemand anderer das auch tat.
Читать дальше