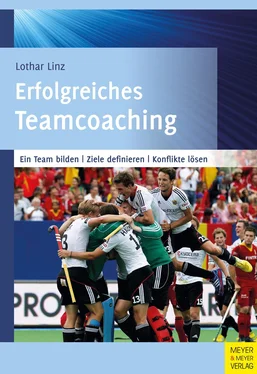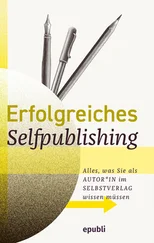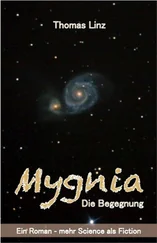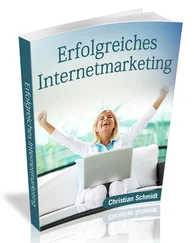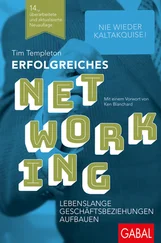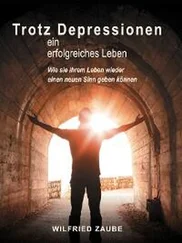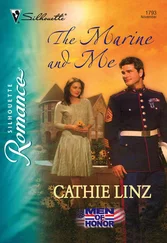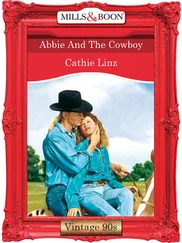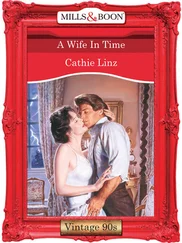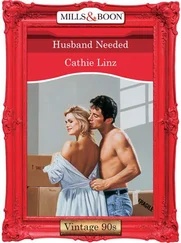Man kann statistisch zeigen (Ingham, Levinger, Graves & Peckham, 1974), dass bei einer Gruppengröße von sechs Personen die individuelle Leistung durchschnittlich um ca. 20% nachlässt. Dieser Effekt tritt vor allem bei Mannschaften auf, wo die Leistung des Einzelnen nicht mehr klar messbar ist, also bevorzugt bei Leistungen wie im Rudern oder im Mannschaftszeitfahren.
Anders als zum Beispiel beim Teamspringen des Skifliegens, wo die Einzelleistungen addiert werden, ergibt sich das Mannschaftsergebnis bei diesen Disziplinen aus einer nicht genau auf den Einzelnen zurückführbaren Leistung aller zusammen. Sie können nicht feststellen, welcher Radfahrer wie viel zum Endergebnis beigetragen hat.
Im Ballsport ist das schon etwas besser erfassbar, etwa über gewonnene Zweikämpfe, Trefferzahlen, Assists usw. Deshalb wird im Ballsport das Phänomen der „sozialen Faulheit“ nur in begrenztem Rahmen auftreten.
Viele Menschen haben zudem Angst, in einer Gruppe zu sehr aufzufallen. Lieber halten sie sich etwas mehr zurück. Beides aber, die „soziale Faulheit“ wie auch die Angst vor dem Auffallen, gereicht einer Sportmannschaft zum Nachteil. Sie brauchen es als Trainer, dass jeder Athlet bereit ist, innerhalb seiner ihm zugedachten Aufgabe die volle Verantwortung zum Wohle der Mannschaft zu übernehmen und sich ganz einzusetzen, auch auf die Gefahr hin, positiv (oder negativ, z. B. durch einen folgenschweren Fehler) herauszuragen.
Das erfordert natürlich von den Spielern ein hohes Maß an Selbstvertrauen und mir ist bewusst, dass viele Athleten das nicht mitbringen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie als Trainer langfristig das individuelle Selbstbewusstsein fördern. Dies erreichen Sie, indem Sie den Athleten Erfolgserlebnisse verschaffen, indem Sie ihnen ein Gefühl der Fähigkeit und Wertigkeit vermitteln und indem Sie immer wieder ihre Stärken herausstellen.

Bei Mannschaften wie dem Bahnvierer ist die Gefahr der „sozialen Faulheit“ zu beachten.
Foto: ©Picture Alliance/dpa
3.8 Konformität kontra Individualität
„Die Kosten, die in einem erfolgreichen Team jedes einzelne Mitglied tragen muss, sind sehr hoch. Am Ende einer Teamreise werden sie aber durch eine viel höhere Auszahlung gerechtfertigt.“ Ralph Krueger (2001)
Auf die meisten Menschen wirkt eine Gruppe so, dass sie versuchen, die Anerkennung der Gruppe zu erhalten. Die Folge ist, dass sie sich anpassen. Wir geben also in der Regel ein Stück unserer Individualität auf, um Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen zu gewinnen. Das ist normal und es ist auch so, dass eine Gruppe diese Bereitschaft des Einzelnen, etwas Eigenes zu Gunsten der Gruppe zu opfern, benötigt. Dieses Opfer des Einzelnen bildet die Grundlage für den Erfolg eines Teams.
Das Wunder des Teams: Jeder gibt etwas und am Ende haben alle mehr.
Jedoch, wie (fast) immer im Leben, gibt es auch ein Zuviel. Wenn eine Gruppe vom Einzelnen zu viel Opferbereitschaft fordert, hat das negative Konsequenzen. (Totalitäre Systeme sind ein Beispiel für die negativen Folgen eines übertriebenen Konformitätsdrucks). Vielmehr muss der Einzelne seinen Beitrag „gerne“ leisten.
Damit meine ich, dass es ihm notwendig und sinnvoll erscheinen muss. Wenn das nicht gegeben ist, wenn ich also das Gefühl habe, etwas geben zu müssen, was ich nicht geben will, dann erzeugt das in mir Widerstand.
Wir Psychologen sprechen dann vom Reaktanzphänomen. Damit ist die Beobachtung gemeint, dass Menschen, wenn sie sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlen, aus dieser Drucksituation ausbrechen, etwa, indem sie genau das Gegenteil des Geforderten tun. Bei Kindern kann man das sehr schön beobachten. Wie oft machen sie genau das Gegenteil von dem, was ihre Eltern sagen. (Wobei es für das „widerspenstige“ Verhalten bei Jugendlichen zusätzlich den Grund gibt, dass sie sich über den Widerstand von den Älteren emanzipieren und ihre neue Rolle finden.)
Die Kunst innerhalb jeder Gruppe besteht also darin, ein ausgewogenes Maß zwischen der erforderlichen Konformität (z. B. einheitliche Spielkleidung, pünktliches Erscheinen am Treffpunkt, Einhaltung eines taktischen Grundkonzepts) und der persönlichen Individualität herzustellen. Erst die Individualität erlaubt Kreativität, aber ein gewisses Maß an Disziplin ist ebenso erforderlich.
Sehr schön verdeutlichen lässt sich dieses Spannungsfeld bei der Thematik der Zielsetzung. Jeder Spieler hat mannschaftliche und individuelle Ziele. Vielleicht will er mit der Mannschaft aufsteigen und selbst in die Landesauswahl berufen werden. Nicht immer sind diese Ziele aber miteinander vereinbar. Bei dem gerade genannten Beispiel mag das noch einfach sein. Wenn er gute Leistungen in der Vereinsmannschaft bringt, wird diese mehr Erfolg haben.
Das wiederum führt dazu, dass der Verbandstrainer auf ihn als Mitglied dieser erfolgreichen Mannschaft eher aufmerksam wird. So weit, so gut. Was aber geschieht, wenn zum Beispiel ein Stürmer das persönliche Ziel hat, in der Saison 20 Tore zu erzielen? Besteht dann nicht die Gefahr, dass er darauf fixiert ist, in offensiven Spielsituationen selbst den Abschluss zu suchen, anstatt den Ball zum besser postierten Mitspieler zu passen? Für die Mannschaft ist es egal, wer das Tor erzielt, Hauptsache, es wird erzielt. Es ist also wichtig, dass die individuellen Ziele mit dem Mannschaftsziel vereinbar sind. Die Mannschaft braucht es, dass der Einzelne individuelle Ziele hat. (Ich gehe sogar so weit, zu behaupten, dass das Team den Einzelnen bei der Erreichung seiner Ziele unterstützen muss, zumindest so weit das mit der eigenen Zielsetzung vereinbar ist.) Aber das Ziel der Mannschaft steht immer über den Zielen des Einzelnen! Wer das nicht verstanden hat, ist im Mannschaftssport falsch. Wie sagt der Erfolgscoach Ralph Krueger (2001) dazu so schön:
„Ein Teamspieler fragt: Was ist das Beste für die Mannschaft? Und tut es!“

Wie viel Konformität benötigt ein Team?
Foto: ©Picture Alliance/dpa

Wie viel Individualität erlaubt ein Team?
Foto: ©Picture Alliance/dpa
4 Der Trainer als Führungsperson
Lassen Sie mich zur Einführung eine kurze Geschichte erzählen: Vor einiger Zeit hatte meine Frau mit ihrem Chor Wandertag. Einige Chormitglieder hatten die Vorbereitung des Tages übernommen, für das anschließende Grillen eingekauft usw. Sie hatten auch eine Wanderroute ausgesucht, doch auf Grund des nassen Wetters erwies sich diese als ungeeignet. Deshalb wurde spontan beschlossen, einen anderen Weg zu nehmen. So gingen wir los.
Schnell zeigte sich ein Problem. Diese Alternativroute war nicht ausgearbeitet worden. Immer, wenn wir an eine Abzweigung kamen, entstand deshalb eine kurze Diskussion, welchen Weg wir nun nehmen wollten. Dabei versäumten es die Organisatoren, die Führung zu übernehmen. So entschied mal der eine, mal die andere, wie es weiterginge.
Zunehmend wurde der Marsch angesichts dieses Führungsvakuums gelähmt. Das Resultat war schließlich, dass nach zwei Dritteln der Wegstrecke ich, der eigentlich nur dazugekommene Gast, kurz entschlossen das Zepter übernahm. Von nun an lief die gesamte Gruppe den Rest des Weges zügig und ohne weitere Diskussionen bis zu unserem Ziel.
Читать дальше