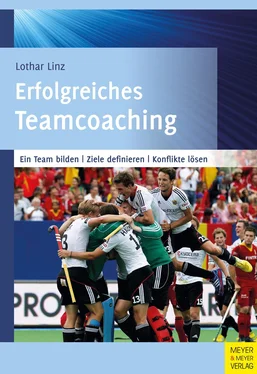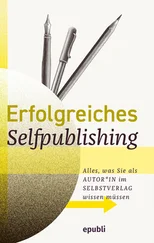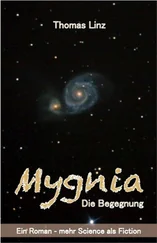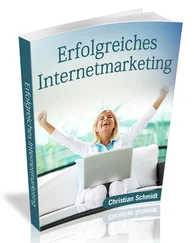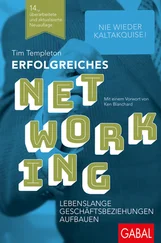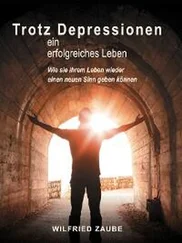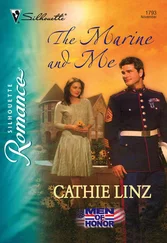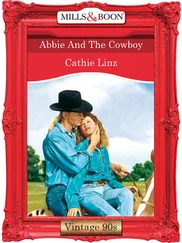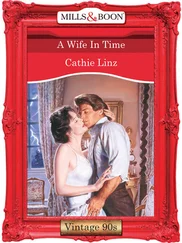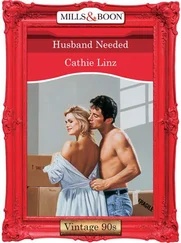Doch kommen wir von dieser allgemeinen Betrachtung zurück zum Sport. Was für die ganze Welt gilt, gilt nämlich auch für jedes andere System. Die Mitglieder innerhalb eines Systems sind alle miteinander verbunden. Diese Verbindungen sind nicht jederzeit deutlich und sichtbar, aber sie bestehen immerzu. Sobald sich ein Systemmitglied verändert, verändert sich deshalb das gesamte System. Man kann sich das am besten als ein großes Netz vorstellen. Wir Menschen bilden die Knoten und die Seile dazwischen unsere Verbindungen. Wenn Sie am Ende des Netzes ziehen, kommen die Auswirkungen in abgeschwächter Form auch am anderen Ende des Netzes an. Wie die Ringe auf dem Wasser eines Sees bis zum anderen Ufer reichen, wenn Sie einen Stein hineinwerfen. Eine Mannschaft ist auch ein großes Netz. Was der eine Spieler tut, beeinflusst jeden anderen. Wenn ein Spieler einen Fehler macht, kann es passieren, dass dadurch alle gemeinsam verlieren. Genauso kann die Tat eines Spielers das gesamte Team vor dem Abstieg retten.
Dies macht deutlich, dass jedes Teammitglied wichtig ist. Wirklich jedes, auch der schwächste Ersatzspieler. Im Guten wie im Schlechten ist selbst er in der Lage, eine Menge für oder gegen das Wohl des Ganzen zu bewirken.
3.5 Systemische Gruppenregeln
In den letzten Jahren hat die systemische Therapiesehr an Bedeutung gewonnen. Bei einer dieser psychologischen Sichtweisen auf das Entstehen und Lösen von Problemen, Krankheiten und Konflikten handelt es sich um die Familienaufstellung nach Hellinger (Hellinger, 1990). Diese Form der Gruppenarbeit verdeutlicht, dass es grundsätzliche Regeln gibt, die für alle Gruppen gelten. Es spielt keine Rolle, ob es sich um Familien, Interessengemeinschaften, berufliche Organisationen, Parteien, Vereine oder eben auch um Mannschaften handelt. Wenn ich sage, dass solche Regeln „gelten“, dann meine ich damit nicht, dass diese Regeln vereinbart wurden, oder dass sie nachvollziehbar sein müssen. Diese Regeln bestehen einfach und man kann es erfahren. Beobachten Sie in den nächsten Tagen Ihre Mannschaft. Sie werden vermutlich einiges von dem, was ich im Folgenden darstelle, wiederfinden. Viele Trainer haben mir dies in meinen Vorträgen schon bestätigt.
Dass die grundlegenden Regeln für ein Sportteam mit denen einer Familie übereinstimmen, ist übrigens gar nicht so überraschend, wie es vielleicht manchem Leser auf den ersten Blick erscheint. Das Wort Team stammt nämlich aus dem Altenglischen und meint Familie! Die Familie scheint also so etwas wie das „Urteam“ zu sein. Kein Wunder, wo wir doch alle unsere ersten Erfahrungen mit einer Gemeinschaft in der Familie machen. (Es gibt übrigens noch eine zweite Herkunftsbedeutung des Wortes Team. Dieses steht auch für ein Gespann. Ein Gespann zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es gemeinsam „an einem Strang“ zieht, eine sehr sinnbildliche Beschreibung der Tätigkeit von Teammitgliedern.)
Welche Regeln (oder auch Ordnungsprinzipien) sind es nun, von denen ich die ganze Zeit spreche? Hellinger meint damit Folgendes:
Jeder hat ein Recht auf Zugehörigkeit.
Wer zuerst da war, hat Vorrang.
Es bedarf eines Ausgleichs zwischen Geben und Nehmen.
Das Recht auf Zugehörigkeitsteht für etwas Elementares. Wir alle haben das Bedürfnis, zu unseren Systemen dazuzugehören. Kaum ein Mensch fühlt sich wohl, wenn er in seiner Familie, seiner Schulklasse, seinem Arbeitsteam oder seiner Sportmannschaft „außen vor“ ist. Wir finden unsere Identität über die Zugehörigkeit zu Gruppen. Das umschreibt die eine Seite dieses Ordnungsprinzips.
Zugleich aber haben wir auch ein Recht auf diese Zugehörigkeit. Wenn wir in eine Familie hineingeboren werden, dann sind wir für den Rest unseres Lebens Teil dieses Systems. Das kann uns niemand verwehren. Gerade aber das geschieht oftmals, etwa bei einem schwarzen Schaf in der Familie, welches angeblich gegen die Familienregeln verstoßen hat. Wenn die Familie dieses Mitglied ausschließt, so hat das negative Folgen für das gesamte System. Ganz ähnlich verhält es sich bei Sportmannschaften. Nur mit dem Unterschied, dass hier die Bindung nicht ein Leben lang bestehen muss. Natürlich können wir einen Verein wechseln oder die Mannschaft kann sich von einem Spieler trennen. Aber wichtig ist dabei, wie das geschieht und warum. Wenn Athleten ohne guten Abschied und ohne triftige Ursache ausgeschlossen werden, dann wirkt sich das negativ auf die Mannschaft aus. Und wenn ein Athlet im Unguten geht, so bleibt auch das nicht ohne Wirkung.
Damit Sie sehen können, dass das kein theoretisches Gerede ist, sondern sich dahinter wirkliche Erfahrungen verstecken, möchte ich ein Beispiel einer Leichtathletiktrainingsgruppe vorstellen, welche ich vor einigen Jahren gecoacht habe. Dieses Team bestand aus einer Trainerin und vier Athletinnen. Es kam zwischen der besten Athletin und der Trainerin zu einem Konflikt, der bald öffentlich über die Medien ausgetragen wurde und schließlich dazu führte, dass die Athletin den Verein im Streit verließ. Als ich in der folgenden Saison dazukam, blieben die Leistungen der verbliebenen Athletinnen hinter den Erwartungen zurück. Eine überzeugende Antwort auf die Frage nach den Gründen dafür konnte keine der Beteiligten liefern. Irgendwann kam ich auf die Idee, die Thematik des Weggangs der früheren Topathletin wieder aufzugreifen. Mithilfe einer speziellen Aufstellungsmethodik (siehe Hellinger, 1990) machte ich sichtbar, dass diese Erfahrung noch immer auf der gesamten Gruppe lastete. (Übrigens blieb auch die im Streit weggegangene Athletin hinter den Vorjahresleistungen zurück!) Wir mussten also den Abschied noch einmal in guter Weise nachvollziehen.
Mit „guter Weise“ meine ich, dass der Athletin die verdiente Achtung für ihre Leistungen in der Gruppe und für ihren Entschluss, das Team zu verlassen, zugesprochen wurde. Die Folge dieser rituellen Handlung bestand darin, dass zum einen den einzelnen Athletinnen wieder ein persönlicher Zugang zu ihrer früheren Kameradin möglich war. Vor allem aber konnten alle drei im folgenden Jahr ihre Leistungen deutlich steigern!
Das Recht auf Vorrangdes Erstgekommenen ist etwas, was zu früheren Zeiten viel natürlicher gehandhabt wurde. Es war z. B. selbstverständlich, dass der Erstgeborene der Thronfolger war oder dass er den Hof erbte, unabhängig davon, ob er der Geeignetste für diese Tätigkeit war. Das galt auch für den Sport. Die Balltasche musste immer der jüngste Spieler der Mannschaft tragen.
Als Ausgleich für diese Vorzüge haben die Älteren auch mehr Pflichten und die größere Verantwortung zu tragen als die Jüngeren. Starben die Eltern, so musste der älteste Sohn die Geschwister ernähren und die älteste Tochter führte den Haushalt. Bezogen auf den Sport, verhält es sich in der Regel so, dass die älteren Spieler den entscheidenden Elf- bzw. Siebenmeter ausführen. Sie bekleiden das Amt des Mannschaftskapitäns und müssen ihr Team durch die schwierigen Momente führen.
Es geht also nicht darum, jemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Mit dieser Grundregel ist nur eine einfache Lebenserfahrung gemeint, die wir alle machen können und deren Einhaltung dem gesamten System dient. Heutzutage sind wir als Folge der 68er Generation und der Emanzipation versucht, alle Menschen in einer überzogenen Weise gleich zu machen. Aber mir scheint, dass uns das nicht gut tut.
Gleichwertigkeit ist etwas völlig anderes als Gleichmacherei. Jeder im System hat denselben Wert. Ich kann gleichwertig sein, aber sehr unterschiedliche Aufgaben übernehmen und eine unterschiedliche Position im Team besetzen. Auch wenn es konservativ erscheinen mag, ich erlebe immer wieder, wie viel Ruhe in eine Mannschaft kommt, wenn solche Ordnungsprinzipien wie das Recht auf Vorrang berücksichtigt werden.
Читать дальше