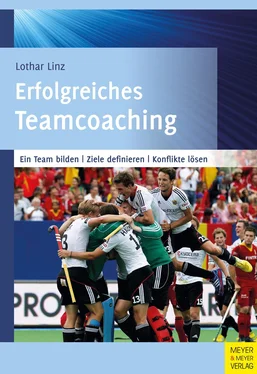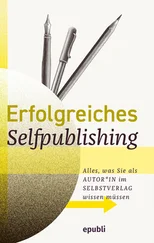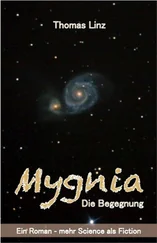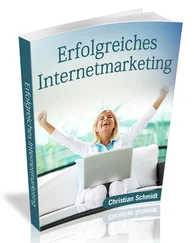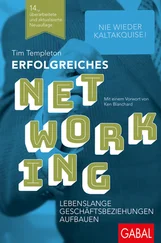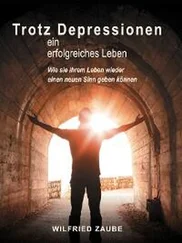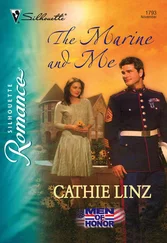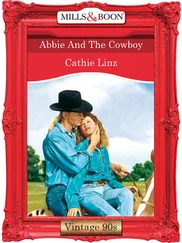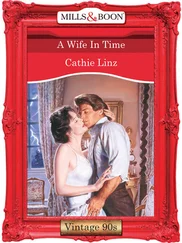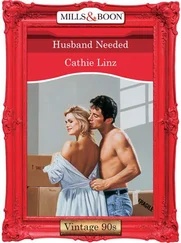2.3 Weitere wichtige Aspekte der Kommunikation
Jetzt haben Sie gelernt, dass es wichtig ist, bei der Kommunikation sowohl auf die Sachaussage wie auf die Beziehungsaussage zu achten. Und Sie haben ein einfaches Modell kennen gelernt, welches Ihnen hilft, die Beziehungsebene positiv zu gestalten. Zuletzt will ich Ihnen noch einige weitere Aspekte der Kommunikation verdeutlichen, die ebenfalls für Sie als Trainer eine Rolle spielen.
Sicher sind Sie sich bewusst, dass wir nicht nur über die Sprache Mitteilungen an unsere Mitmenschen senden, sondern genauso über unseren Tonfall, den Gesichtsausdruck (= Mimik) und den Körperausdruck (= Gestik). Wir unterscheiden deshalb zwischen verbaler (= sprachlicher) und nonverbaler (= Körpersprache) Kommunikation. Beide sind gleich wichtig. Die nonverbale Kommunikation wird aber häufig unterschätzt. Denn sie ist immer aktiv.
Sie können schweigen, aber Ihr Körper wird jederzeit Botschaften aussenden. Deshalb hat der bekannte polnische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick (2000) auch die interessante Aussage getroffen: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Zugegebenermaßen ein zunächst kompliziert erscheinender Satz. Aber seine Wahrheit ist einfach und offenbar. Wenn jemand Sie etwas fragt und Sie nicht antworten, dann ist das auch eine Antwort. Nämlich entweder, dass Sie die Frage nicht verstanden haben, oder dass Sie sie nicht beantworten wollen bzw. können.
Und es gibt ein weiteres interessantes Phänomen innerhalb der Kommunikation: die doppelten Botschaften. Damit ist gemeint, wenn jemand gleichzeitig zwei widersprüchliche Aussagen trifft, indem er sprachlich den anderen auffordert, näher zu kommen, gleichzeitig sein Körperausdruck aber verschlossen ist. Was soll der andere tun? Hört er auf die Worte oder auf den Körper? Auf Dauer blockieren solche doppelten Botschaften den Gesprächspartner. Deshalb ist es wichtig, möglichst übereinstimmend zu sein, in dem, was man empfindet und was man sagt. Denn der Körper drückt häufig unmittelbarer unsere Haltungen und Empfindungen aus. Die Sprache können wir insgesamt besser kontrollieren.
Je ehrlicher Sie also sind, desto eindeutiger wird auch Ihr Ausdruck und desto besser wissen die Athleten, wo sie bei Ihnen dran sind. (Das ist auch das Problem, wenn Sie als Trainer mit dem Stilmittel der Ironie arbeiten. Ironie macht nur dann Sinn, wenn man sicher sein kann, dass sie vom Gegenüber als solche verstanden wird. Aber da der Selbstausdruck bei der Ironie zwangsläufig widersprüchlich ist, sind hier Missverständnisse fast schon vorprogrammiert.)
Sicher wäre noch viel mehr zu diesem Thema zu sagen, aber mit den hier beschriebenen Begriffen und Modellen sind Sie als Trainer in der Lage, die wichtigsten Missverständnisse aufzuklären und zukünftige Kommunikationsprozesse effektiv zu gestalten, sodass es Ihnen in Zukunft noch besser gelingen wird, mit Ihren Athleten in fruchtbaren Kontakt zu treten.

Davie Selke (L), U21 Nationaltrainer Stefan Kuntz (R): Gelungene, offene Kommunikation ist die Grundlage für eine positive Beziehung.
Foto: ©Picture Alliance/dpa
3 Was ist ein Team? Gruppenregeln und Gruppendynamik
Wenn wir von Sportmannschaften sprechen, benutzen wir gerne Begriffe wie Teamgeist, Mannschaftsgefüge usw. Was aber verbirgt sich hinter solchen Worten? Was ist überhaupt ein Team? Gibt es übergreifende Regeln, nach denen Gruppen funktionieren? Und wie beeinflussen sich die einzelnen Mitglieder gegenseitig? Auf solche Fragen will das folgende Kapitel Antworten geben.
3.1 Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile
Wir Menschen sind in unserer Grundnatur soziale Wesen. Das bedeutet, dass wir immer aufeinander bezogen sind. Wenn mehrere Menschen zusammenkommen, bilden sie nicht nur eine Ansammlung von Individuen. Sie sind mehr. Gemeinsam entsteht ein neues Ganzes.
Eine Mannschaft besteht demnach nicht nur aus fünf, sieben oder elf Spielern, sie bildet eine neue, größere Einheit. Und je besser eine Mannschaft funktioniert, desto größer wird der Mehrwert, den diese Einheit ausmacht.
Auf Grund dieser Tatsache gilt für alle Gruppen eine einfache Regel: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Um diesen Satz noch besser zu verstehen, stellen Sie sich eine einfache Frage: Wie kommt es, dass die deutsche Damenstaffel im olympischen Langlauf 2002 die Norwegerinnen schlagen konnte? In der Addition der Einzelzeiten waren die Skandinavierinnen doch viel besser. Der Grund liegt darin, dass es nicht möglich ist, einfach die Einzelteile zu addieren. Das Ganze ist eben mehr als das. Es bildet eine neue Einheit, eine neue Dynamik, einen neuen Wert.
Von diesem größeren Ganzen getragen, entwickelten die deutschen Langläuferinnen ein solches Leistungsvermögen, dass jede Einzelne über ihre Grenzen hinauswuchs.
Nicht umsonst betonen viele Athleten, dass es für sie etwas Besonderes ist, in der Staffel oder im Mannschaftswettbewerb zu starten. Die Übung „Der Sitzkreis“ (siehe Kasten hier Übung 1: Der Sitzkreis Lassen Sie Ihre Athleten einen Kreis bilden. Achten Sie darauf, dass sie ganz dicht stehen. Bitten Sie sie, sich im Uhrzeigersinn auszurichten. Jeder Athlet schaut jetzt auf den Rücken seines Vordermanns. Lassen Sie alle noch enger zusammenrücken. Und jetzt fordern Sie sie auf, sich auf Kommando auf die Oberschenkel des Hintermanns zu setzen. Wenn alle mitmachen, entsteht ein stabiler Sitzkreis. Was aber passiert, wenn Sie nun ein oder zwei Mitglieder aus dem Kreis nehmen? Diese Übung können Sie gut nutzen, um zu zeigen, dass eine Mannschaft mehr ist als „die Summe ihrer Einzelteile“. Außerdem können Sie einige wesentliche Faktoren aufzeigen, wie eine Mannschaft funktioniert. Nämlich indem jeder seinen Beitrag gibt, sich „einreiht“ und zugleich sich den anderen zumutet, den anderen auch vertraut. Außerdem zeigt diese Übung, wie wichtig eine Person ist, welche die Kommandos gibt. Wegen dieses Summierungseffekts ist es für einen Trainer auch so schwierig, wenn seine Mannschaft nicht mehr zusammenhält, sondern in einzelne Grüppchen und Individuen zerfällt. Dann geht genau diese zusätzliche Kraft verloren. Dann steht Ihnen als Trainer wirklich nur die reine Summe der Einzelteile zur Verfügung, (möglicherweise sogar noch weniger, wenn sich die eigenen Spieler gegenseitig, ob absichtlich oder unabsichtlich, behindern). Und das ist gegen die meisten echten Mannschaften, auch wenn sie in ihren individuellen Möglichkeiten unterlegen sind, zu wenig, um zu gewinnen. Foto: ©Lothar Linz Deshalb wird auch so oft vom Teamgeist gesprochen. Der Teamgeist ist genau die Kraft, die keiner richtig beschreiben kann, aber jeder schon einmal erlebt hat. Die Kraft, die eine Mannschaft eint und jeden Einzelnen anspornt. Die Kraft, welche dem Außenseiter hilft, den Favoriten besiegen zu können.
) bietet eine schöne Möglichkeit, Ihren Spielern den Mehrwert einer Mannschaft erfahrbar zu machen.
Übung 1: Der Sitzkreis
Lassen Sie Ihre Athleten einen Kreis bilden. Achten Sie darauf, dass sie ganz dicht stehen. Bitten Sie sie, sich im Uhrzeigersinn auszurichten. Jeder Athlet schaut jetzt auf den Rücken seines Vordermanns. Lassen Sie alle noch enger zusammenrücken. Und jetzt fordern Sie sie auf, sich auf Kommando auf die Oberschenkel des Hintermanns zu setzen. Wenn alle mitmachen, entsteht ein stabiler Sitzkreis. Was aber passiert, wenn Sie nun ein oder zwei Mitglieder aus dem Kreis nehmen?
Diese Übung können Sie gut nutzen, um zu zeigen, dass eine Mannschaft mehr ist als „die Summe ihrer Einzelteile“. Außerdem können Sie einige wesentliche Faktoren aufzeigen, wie eine Mannschaft funktioniert. Nämlich indem jeder seinen Beitrag gibt, sich „einreiht“ und zugleich sich den anderen zumutet, den anderen auch vertraut. Außerdem zeigt diese Übung, wie wichtig eine Person ist, welche die Kommandos gibt.
Читать дальше