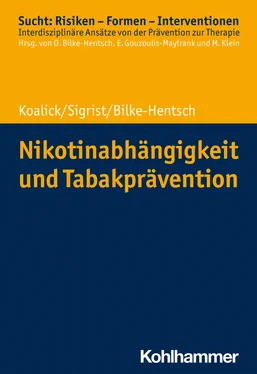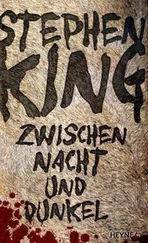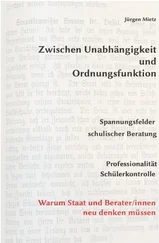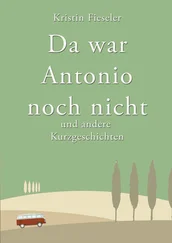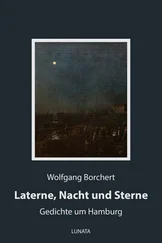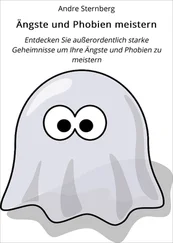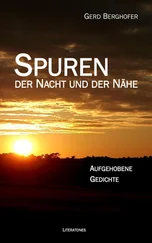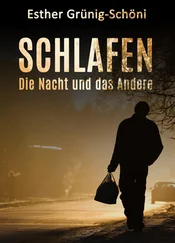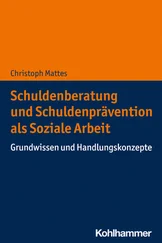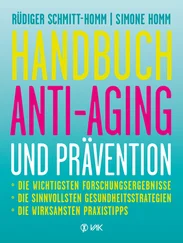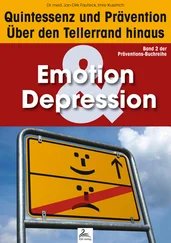3. Elektronische Abgabesysteme ohne Nikotin (Electronic Non-Nicotine Delivery Systems/ENNDS) sind ähnlich wie ENDS, aber die erhitzte Lösung enthält generell kein Nikotin. Diese Produkte werden proaktiv vermarktet oder gefördert als »sauberere« Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten, als Rauchstopphilfen oder als Produkte mit »reduziertem Risiko«.
Einige dieser Produkte haben de facto niedrigere Emissionen als herkömmliche Zigaretten, sie sind aber nicht risikofrei, und die Auswirkungen auf Gesundheit und Mortalität sind noch weitgehend unbekannt. Es existieren keine unabhängig erforschten Belege zur Verwendung dieser Produkte bei Interventionen zur Tabakentwöhnung.
Es bleibt letztlich Unsicherheit im Zusammenhang mit der potenziellen Toxizität von ENDS, obwohl diese einigen Rauchenden geholfen haben, mit dem herkömmlichen Rauchen aufzuhören unter bestimmten Bedingungen. Der wissenschaftliche Beweis ist nicht schlüssig, und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von randomisierten Kontrollversuchen und Längsschnittstudien. Die Untersuchung der Rolle von ENDS als angebotene Entzugshilfe und die entsprechenden Schlussfolgerungen sind nicht eindeutig. Mögliche Fehlinformationen durch die Tabakindustrie über E-Zigaretten sind eine gegenwärtige und reale Bedrohung. Angesichts der Knappheit und geringen Qualität der wissenschaftlichen Beweise ist es noch unklar laut der WHO (2020), den Einsatz der E-Zigarette als Methode zum Rauchstopp zu empfehlen.
1.5 Typische Fälle
Jugendlicher
Der 16-jährige Ma. raucht seit seinem 11. Lebensjahr. Die sehr natur- und ernährungsbewusst lebenden Eltern (vegan, Lehrerin und Richter) haben neben Ma. noch den drei Jahre älteren Tobias und die fünf Jahre jüngere Katharina als Kinder. Ma., der sich wegen seiner Impulsivität und Konzentrationsschwächen im Rahmen eines ADHS leicht langweilt, schließt sich dem wesentlich interessanteren Freundeskreis seines älteren Bruders an, probiert dort allerhand Risikoverhaltensweisen aus und gewinnt schnell ein starkes Selbstvertrauen, was ihn – ansonsten sozial etwas ungeschickt – von seinen Gleichaltrigen abhebt. Das Zigarettenrauchen vor allem beim Skaten oder beim »Rumhängen« gehört für einige in der Gruppe dazu, das Kiffen ist bei Älteren beliebt. Ma. stellt schnell fest, dass er im Gegensatz zu anderen Jugendlichen die Zigaretten sehr gut »verträgt«, auch sehr schnell eine stark anflutende Wirkung hat, die aber ebenso schnell wieder verschwindet. Während sich andere aus der Gruppe die Zigaretten einteilen, hat Ma. ständig Zigarettenmangel, versucht diese bei anderen zu erhalten oder sich diese anderweitig zu erschleichen. Die Beschaffung, Lagerung, das Verstecken und das heimliche oder offene Rauchen wird zu einem bestimmenden Lebensthema. Ma. entdeckt, dass er seine plötzlichen Stimmungsschwankungen, seine Kränkungen und Enttäuschungen (die er als solche so nicht benennen kann) mit der schnell verfügbaren Zigarette sehr kurzfristig steuern und ungeschehen machen kann.
Der Einfluss der Eltern ist und bleibt gering, ihr Vorbildcharakter interessiert Ma. eher wenig, dafür sind die Wirkung und die unangenehmen Entzugserscheinungen zu bedeutend geworden. Auch als der Bruder sich aus dem Freundeskreis verabschiedet und keine Substanzen mehr zu sich nimmt, verbleibt Ma. bei der älteren Gruppe und hat, nachdem er einmal sitzen geblieben ist und die Schule für ihn weiterhin sehr langweilig ist, umso mehr Zeit. Während des Gamens, bei dem er schnelle Reaktionsspiele mit hohem Aggressionsinhalt bevorzugt und weniger Strategiespiele, wird er faktisch zum Kettenraucher. Die Aussage einiger Klassenkameradinnen, die den an sich sehr sportlichen und attraktiven Ma. näher kennenlernen wollen, er »stinke immer nach Rauch und Nikotin«, bestärkt ihn in seiner Einschätzung der beschränkten Einsichtsfähigkeit von Mädchen seines Alters. Zur Volljährigkeit hin verbittet er sich von seiner Umgebung jegliche Einflussnahme auf sein Rauchverhalten.
Ein 76-jähriger Patient befindet sich nach einer Lungenentzündung in der Rehabilitation und nimmt an den Gesprächen der Nikotinberatung teil.
Er schwört sich: »Jetzt ist fertig mit Rauchen!« Seine Frau und er, sie brauchen sich, sie ergänzen einander, und im Alter sei das umso wichtiger. Seine Frau habe schon Unfälle mit dem Rücken gehabt, und sie müssten einander helfen. Ihm ist es wichtig, ihr bei den Haushaltsarbeiten wie Staubsaugen zu helfen. Vorher habe man das gar nicht so bemerkt – erst jetzt, als er die akute Lungenentzündung hatte, sei es das Erste gewesen, das ihm in den Sinn gekommen war.
Herr B. erlebte seinen Zustand als lebensbedrohlich. Er erfuhr einen schweren Atemnotanfall zu Hause und musste mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Er erinnert sich an die Intensivstation und wie schwer er es dort hatte. Auf der einen Seite konnte Herr B. nicht auf der Intensivstation rauchen durch seinen schlechten Allgemeinzustand, gleichzeitig entstand der Entschluss, mit dem Rauchen aufzuhören.
Auf die Frage, was es gebraucht habe, dass er sagt: »Ich will rauchfrei bleiben!«, sagt er, die Lungenentzündung sei sein Aha-Erlebnis gewesen. Herr B. hatte vor dem Ereignis schon mehrere Aufhörversuche – mal eine Woche oder tageweise. Er habe es öfter probiert, aber dieses Mal habe es »Klick« gemacht.
Es sei nicht nur ein Husten gewesen, sondern eine schwere Erkrankung. Herr B. ist der Meinung, wenn man so lange rauche, brauche es einen Schock, etwas, das einem »auf den Deckel haut«; seine längsten Rauchstoppversuche in der Vergangenheit dauerten längstens 14 Tage, und dann begann es wieder mit »Ich probiere mal eine«, und dann kam wieder die nächste oder zweite. Er ist überzeugt, dass er diesen Schockmoment der heftigen Lungenentzündung gebraucht hat.
Nach fünf Wochen »rauchfrei« geht es ihm nach eigenen Äußerungen gut. Am Abend kommen noch die Momente: »Jetzt könnte ich auf den Balkon raus und eine rauchen«, aber dieser Moment sei sehr schnell vorbei. Die Ablenkung sei für ihn in der Reha nicht schwer, er habe seine Therapien, gehe wandern, und es sei immer irgendetwas. Er wolle versuchen, sich auch zu Hause mehr zu bewegen. Sie wohnten in Waldnähe, auch mit einer Anhöhe, das sei auch eine gute Therapie. Er könne verschiedene Distanzen machen.
Er will nun das, was er in den Therapien in der Reha gelernt hat, auch zu Hause anwenden.
Für Herrn B. sind die Gründe, rauchfrei zu bleiben, sehr wichtig: seine Lebensqualität, das gemeinsame Leben mit seiner Frau.
Eine 55-jährige depressive Patientin, die während ihres stationären Aufenthalts in der Psychosomatik mit Unterstützung der Nikotinberatung ihren Zigarettenkonsum reduziert, bezeichnet sich als leidenschaftliche Raucherin. Sie würde gern rauchen und bewundere die Leute, die von einem Tag auf den anderen mit dem Rauchen aufhören. Sie weiß, dass das für sie nicht stimmen würde. Sie brauche das Bewusstsein, das sei für sie die Grundlage, ihr Verhalten zu ändern.
Die erste Zigarette rauchte sie zu Hause nach dem Aufstehen, jetzt in der Klinik würde erst der Kaffee kommen ohne die Zigarette.
Sie habe den Zigarettenkonsum reduziert, indem sie verschiedene Zigaretten ausgelassen habe, und das sei gegangen. Das Rauchverhalten zu verändern, sei aufgrund ihrer Gesundheit wichtig für sie; sie habe Glück gehabt mit ihrer Diagnose, nachdem die Lunge untersucht worden war. Der Befund sei nicht so schlimm gewesen wie vermutet. Das habe ihr wieder Motivation gegeben, um erneut einen Rauchstoppversuch zu starten. Sie möchte rauchfrei sein, nicht mehr stinken, nicht krank sein, sie möchte mehr Geld haben und nicht abhängig sein. Das »Dranbleiben« im Prozess wäre für sie also sehr wichtig.
Читать дальше