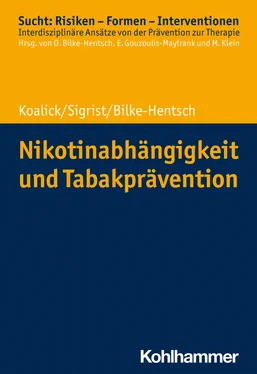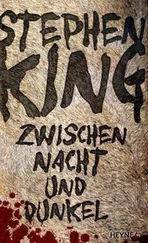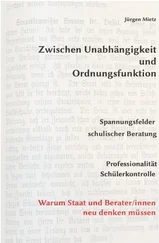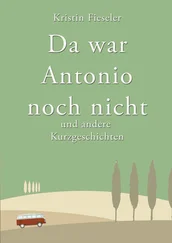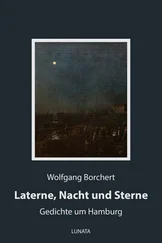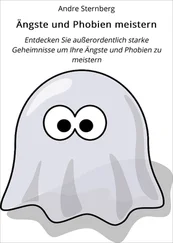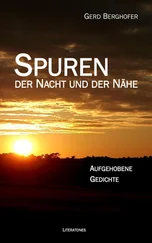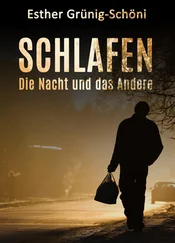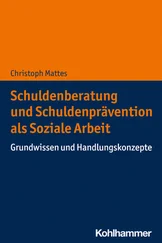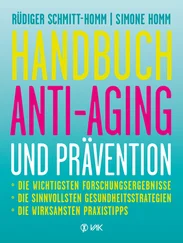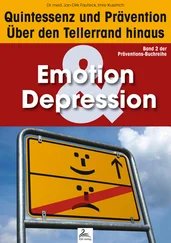Aus diesem Grunde gehen wir in diesem Buch die Thematik von Nikotinabhängigkeit und Tabakprävention aus drei unterschiedlichen Richtungen an. Nach Einführungskapiteln zum Überblick geht es um die präventiven Maßnahmen und den Nichtraucherschutz einerseits sowie um Diagnostik und Therapiemöglichkeiten andererseits. Bearbeitet hat diese Themen hauptsächlich Susann Koalick. Im Weiteren kommen körperliche Wirkungen und Nebenwirkungen zur Sprache, wofür Tom Sigrist als Pulmologe verantwortlich zeichnet. Behandelt werden dabei neurobiologische Themen der Entwicklung, der Suchtdynamik und der individuellen Verläufe, die Oliver Bilke-Hentsch aus (entwicklungs-)psychiatrischer Sicht darstellt. Wir hoffen, damit den Leserinnen und Lesern bzw. Nutzerinnen und Nutzern ein angemessenes Spektrum an Zugangsweisen zu ermöglichen. Aufgrund der langjährigen Tätigkeit aller drei Verfassenden im Kontext des Global Network for Tobacco free Healthcare Service (GNTH) bzw. des Forums Tabakprävention in Gesundheitsinstitutionen der Schweiz (FTGS) kommen auch strukturelle, institutionelle und damit gesundheitspolitische Themen zur Sprache.
Im Herbst 2021
Susann Koalick, Barmelweid/Zürich
Dr. med. Thomas Sigrist, Barmelweid
Dr. med. Oliver Bilke-Hentsch, Luzern/Zürich
1
Einleitung
1.1 Historische Aspekte im Überblick
Die Wirkung von Nikotin war schon vor 10.000 Jahren bei nord- und mittelamerikanischen Völkern bekannt, insbesondere für kultische Zwecke. Tabak galt als heilige Pflanze, und so rauchten beispielsweise die Native Americans im Norden von Amerika bei ihren Vertragsabschlüssen die sogenannte »Friedenspfeife«.
Die Native Americans nutzten die Tabakpflanze aber auch zur Auflage als Wundverbände, somit also medizinisch, und ebenso getrunken als Sud, gekaut sowie auch geschnupft. Schamanen verwendeten den Tabak, um in die Welt der Geister zu reisen und die Seelen Kranker auf die Erde zurückzubringen. Kolumbus bekam die Pflanze als Gastgeschenk nach seiner Landung in San Salvador im Jahre 1492 und brachte sie nach Europa.
Rodrigo de Jerez, ein Mitglied von Kolumbus’ Schiffscrew, war der erste Tabakkonsument, der in Europa Tabak rauchte. Der Rauch ließ die Leute allerdings glauben, der Teufel sei in ihn gefahren, weswegen die Priester der Inquisition ihn ins Gefängnis warfen.
Die heilende Wirkung von Nikotin untersuchte ein französischer Gesandter namens Jean Nicot am portugiesischen Hof, indem er es erfolgreich gegen Kopfschmerz verabreichte. 1590 wurde die Pflanze als Nicotiana bekannt, und seit 1828 ist Nicot der Namensgeber für den Suchtstoff Nikotin. Handelsbeziehungen in alle Welt brachten die Pflanze bis nach Asien und Afrika. Dabei hatte Tabak einen hohen Handelswert, vergleichbar mit heutigen illegalen Drogen.
Als Gebrauchs- und Genussmittel war Tabak im 18. Jahrhundert in vielen Ländern anzutreffen. Zigarren waren die häufigste Form der Anwendung. Die erste Tabakmanufaktur entstand in Sevilla in Spanien. Napoleon brachte die Zigarre mit nach Frankreich, von wo sie nach Deutschland kam und für das Bürgertum zu einem Statussymbol wurde.
1867 wurde auf der Pariser Weltausstellung die erste maschinelle Zigarettenherstellung der Firma Susini aus Havanna vorgeführt.
Mit dieser Entwicklung der Herstellung wurde die Kulturdroge Tabak ab etwa der Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Massendroge. Das Rauchen als Muße wechselte dem Rauchen als Stressbewältigung. Die Zigarette wurde dann ein Symbol für das moderne Leben des 20. Jahrhunderts.
Nichtsdestotrotz wurde das Rauchen auch schon im 19. Jahrhundert, vor 150 Jahren, unter negativen Konsequenzen betrachtet, vor allem der Konsum bei Jugendlichen. Rauchen wurde als soziales Problem angesehen: 10- bis 12-jährige Jungen rauchten, und Lehrer wiesen auf das Problem des »narkotischen Tabaks« hin. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in den USA und in Europa Anti-Tabak-Vereinigungen gegründet. Langzeitschäden wie z. B. Zungenkrebs wurden schon vor 150 Jahren festgestellt.
Bis 1950 bestritt die Tabakindustrie die Tatsache, dass Rauchen Folgeerkrankungen provoziert. Heute verursacht die Tabakepidemie acht Millionen Todesfälle pro Jahr weltweit (WHO 2019).
Seit einigen Jahren hat die sogenannte elektrische bzw. elektronische Zigarette mit und ohne Nikotin Einzug gehalten. Die E-Zigarette wird vielfach als harmlose Alternative zur Zigarette oder als Mittel zum Rauchstopp beworben. Es fehlen bisher Langzeitstudien zu den gesundheitlichen Folgen des E-Zigaretten-Konsums (S3-Leitlinie »Rauchen und Tabakabhängigkeit: Screening, Diagnostik und Behandlung« – AWMF 2021).
Merke: Die Tabakpflanze mit ihrem Wirkstoff Nikotin wurde zu Beginn ihrer Geschichte als Kultmittel und Heilpflanze genutzt. Ab dem 19. Jahrhundert mit fortschreitender Industrialisierung und Verbreitung wurden die negativen Konsequenzen des schädigenden Tabakrauchs und der Suchtwirkung des Nikotins als problematisches Verhalten erkannt und betrachtet. In heutiger Zeit halten umstrittene elektrisch erhitzte Tabakerzeugnisse ihren Einzug.
1.2 Legale und politische Aspekte
Die Tabakindustrie ist ein umsatzstarker Wirtschaftszweig. Während in Westeuropa der Tabakkonsum zurückgeht, wird vor allem in Entwicklungsländern mit einem Anstieg gerechnet.
Die Werbung ist vielfältig und richtet sich gezielt an verschiedene Konsumentengruppen, vor allem Neueinsteigende sind für die Tabakindustrie interessant, da eine neue zukünftige Kundschaft angeworben wird. Je früher mit dem Rauchen begonnen wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, später regelmäßig zu rauchen, desto schwerer fällt das Aufhören (Sussman et al. 1998) und desto stärker ist die karzinogene Wirkung des Zigarettenrauchs (Wiencke et al. 1999). Eine große Anzahl wissenschaftlicher Studien kommt zu dem Ergebnis, dass Zigarettenwerbung sowohl den Einstieg in den Zigarettenkonsum als auch den Übergang vom Probieren zum regelmäßigen und gewohnheitsmäßigen Rauchen und damit die Festigung des Rauchverhaltens fördert (Gilpin und Pierce 1997; Pierce et al. 1998). Dies gilt nicht nur für die direkten Formen der Werbung, sondern auch für die indirekte Werbung für Tabakprodukte (MacFadyen et al. 2001).
Frauen wurden und sind zunehmend eine Zielgruppe als Konsumentinnen, die direkt beworben wird. Berufstätige Frauen sind dabei besonders interessant auch im Zusammenhang mit einem selbstbestimmten Lebensstil. Durch Bilder von Schlanksein, Emanzipation, Kultiviertheit spricht die Tabakindustrie schon lange die Sehnsüchte der Frauen an. Die Zigarettenpackungen wurden vom Aussehen her den Wunschbildern der Frauen angepasst oder auch mit ansprechenden Aussagen untertitelt oder mit Attributen wie Stil und Geschmack versehen.
Zigaretten sind für den Schmuggelmarkt interessant. Durch das Umgehen der Steuern entsteht eine hohe Gewinnspanne. Günstige Schwarzmarktzigaretten steigern den Zigarettenkonsum. Zigaretten gehören weltweit zu den meistgeschmuggelten Konsumgütern.
Die größten wirtschaftlichen Kosten beim Tabak verursachen die Behandlungen von tabakbedingten Krankheiten.
Beispiel Schweiz: Drei Milliarden Franken/2.742 Milliarden Euro zahlt die Gesellschaft pro Jahr in Form von Krankenkassenprämien und Steuern. Keine andere Sucht verursacht derart hohe Kosten im Gesundheitswesen. Zum Vergleich: Alkohol macht mit 477 Millionen Franken nur ein Sechstel aus, Drogen mit 274 Millionen Franken weniger als ein Zehntel. Tabak ist ebenfalls für den Großteil der suchtbedingten Todesfälle verantwortlich. Von 11.512 suchtbedingten Todesfällen im Jahr 2017 entfallen 9.430 auf Tabak, 1.940 auf Alkohol und 178 auf Drogen. Indirekt, also durch krankheitsbedingte Ausfälle am Arbeitsplatz oder durch frühzeitige Todesfälle, kostet der Tabakkonsum die Schweizer Volkswirtschaft jährlich zwischen 833 Millionen Franken und 3,1 Milliarden Franken – abhängig davon, wie breit die indirekten Kosten miteinbezogen werden. In die erste Rechnung werden lediglich die Kosten zur Beschaffung eines »Ersatzes« für die ausgefallene Person miteinbezogen. Die zweite Rechnung berücksichtigt zusätzlich den Verlust über das gesamte Erwerbsleben (AT Schweiz 2020).
Читать дальше