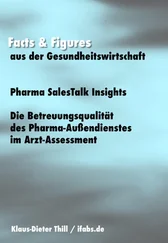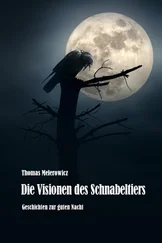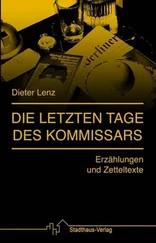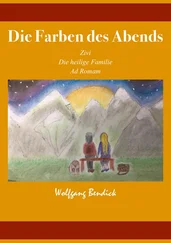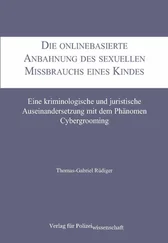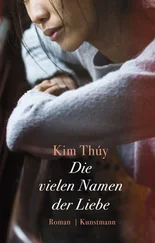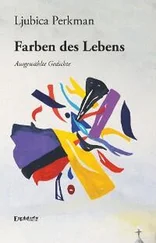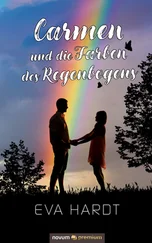Die Schutthalde – dieser Berg aus Kehricht – wurde zum Sündenfall für die ganze Familie. Denn wenn es anfangs auch bloß um das Sammeln von Kupferkabeln, Bleirohren oder um das Sammeln von Zeitungen und Zeitschriften gegangen war, so wurde der Abfallberg mit der Zeit zum »Kleidergeschäft« für die ganze Familie: Die Großmutter riss, vom starken Asthma geplagt, keuchend über die Jahre Tausende von Kehrichtsäcken auf, um ihren Jungen mit Pullovern, Jeans und Schuhen auszustatten. Ja, sogar seine Skischuhe, mit denen er als 12-Jähriger Rennen fuhr, stammten aus einem Kehrichtsack. Dabei war das Aufspüren von etwas Brauchbarem in den unzähligen Kehrichtsäcken nicht einfach. Man brauchte sozusagen ein Auge dafür, wo genau ein kleiner Schatz vergraben sein könnte. Ähnlich einem Pilzesammler im steilen Wald kletterte der Junge Tag für Tag durch den Berg mit Abfallsäcken und Bauschutt hoch und runter. Schlitzte mit Messern die Säcke blitzschnell auf und sortierte deren Inhalt in wenigen Handgriffen gleich vor Ort. Das stank oft fürchterlich aus den aufgeschlitzten Säcken. Wenn die Zeitungen für den Altpapierhandel zuerst von verfaulten Spaghetti Napoli befreit werden mussten. Oder ein schöner roter Skipullover unter abgenagten Pouletknochen zum Vorschein kam. Damals gab’s noch keine Abfalltrennung. Glasscherben, Babywindeln und die begehrten Kupferkabel – alles war im gleichen Sack. Und dann die Fliegen! Es hatte Schwärme von Fliegen im Sommer, die auf dem Abfallberg aus den aufgeschlitzten Kehrichtsäcken lebten. Und waren sie nicht auf dem Abfallberg, dann waren sie ganz sicher in Großmutters Küche. Dort endeten die Fliegen letztlich an Großmutters unzähligen Fliegenfänger-Klebestreifen, die von der Küchendecke herunterhingen. Rücklings, vornüber, sogar stehend waren die Fliegen der Großmutter sprichwörtlich auf den Leim gegangen und summten noch ein paar Stunden wie verrückt weiter. Während gleich darunter am Küchentisch der Junge sein Müsli aß – Champion-Birchermüsli mit Wasser angerührt.
Der Abfallberg war zugleich Segen und Fluch für die Familie. Mehr noch Fluch: Denn es war bloß eine Frage der Zeit, bis die Familie durch ihre Arbeit auf der Schutthalde zum Gespräch wurde. Ohne dass sie es wollten, wurden sie, die am Rande des Ortes wohnten, jetzt zusätzlich zu Außenseitern. Wurde darum der Junge, als er 12 Jahre alt war, unter Vormundschaft gestellt? Das war sicher bitter für die Großmutter und den Großvater – denn nun war es klar, dass andere dachten, sie wären nicht imstande, dem Jungen eine normale Erziehung angedeihen zu lassen. Und der Junge? Er wusste nicht, warum er nun einen Vormund hatte. Er wusste aber eines dafür umso besser: wie es ist, ausgelacht oder bemitleidet zu werden. Beides ist nicht angenehm. Es war nicht angenehm, beim Bauern in der Nachbarschaft am Samstagabend jeweils mit einem Plastikkübel frischen Wurstsalat zu holen, den der Bauer als Schweinefutter von der Migros-Filiale erhalten hatte. Am Sonntag aßen alle Migros-Wurstsalat. Die Schweine des Bauern und der Junge alleine in der dunklen Küche. Für einmal kein Champion-Birchermüsli. Er liebte diesen Wurstsalat und er schämte sich dafür. Er sprach mit niemandem darüber.
Zu seiner Erstkommunion wünschte er sich eine Armbanduhr. Aber es musste eine Armbanduhr mit einer zusätzlichen Stoppuhr sein. Und so stoppte er mit Begeisterung, wie lange er brauchte, um alle drei Bände von Winnetou zu lesen, und rechnete sich sogleich aus, wie lange er für die ganze Karl-May-Buchsammlung des Nachbarn brauchen würde. Genau gesagt rechnete er sich aus, wie lange das grenzenlose Glück anhalten würde, das er beim Lesen von Karl Mays Abenteuerbüchern empfand. Dabei schien es ihm, dass er bei den drei Winnetou-Büchern auf ein unheimliches Geheimnis gestoßen sein müsse. In jedem Fall war es ein auffälliges Muster: Es fiel ihm nämlich auf, dass Winnetou nicht ein einziges Mal auf die Toilette gegangen war. Drei Bücher lang nicht ein einziges Mal gepinkelt. Wie war das möglich? Wollte Winnetou vielleicht Zeit sparen? Hatte er etwa auch eine Stoppuhr? Unter dem Lederwams versteckt – und sagte es niemandem?
Die Zeit zog den Jungen von klein auf in den Bann. Zeit traf er überall an. Sprichwörtlich auf Schritt und Tritt: Wie lange dauerte der Schulweg? Wie viele Sekunden verlor er am Schülerrennen auf den Drittplatzierten? In seinem Leben gab’s von klein auf überall Uhren. Und gleichzeitig war er selbst immer unpünktlich. Es schien, als könne er den praktischen Umgang mit der Zeit nicht recht verstehen. Warum musste er als Erstklässler Punkt neun in der Schule sein? Schließlich hatte er mit Abstand den längsten Fußweg zu bewältigen jeden Morgen. Warum musste man an Weihnachten pünktlich bereit sein fürs Weihnachtsfest? Kam das Christkind mit dem 8-Uhr-Abend-Zug?
Mit der Frage der Zeit befasste sich der Junge intensiv, als er seinen ersten eigenen Kuchen buk. Dies war ein Feldversuch über die Wirkung der Zeit sozusagen. Genau gesagt »die Wirkung der Zeit im Verhältnis zur Temperatur im Backofen«. Die alles entscheidende Frage war: Warum schmeckte sein Kuchen nicht, den er 5 Stunden und 10 Minuten lang im Backofen ließ?
Dabei war der Kuchen keineswegs verbrannt, denn er hatte die im Rezeptbuch angegebene Backzeit von 30 Minuten auf 5 Stunden verlängert – sozusagen ums 10fache gedehnt, aber gleichzeitig die Backtemperatur von 220 Grad um ebenfalls das 10fache reduziert. Auf 22 Grad. Schmeckte der Kuchen nun so seltsam, weil der Backofen sich nicht exakt auf 22 Grad einstellen ließ? Oder war es, weil unser kleiner Held nicht genau nach 5 Stunden wieder zu Hause war? Er kam leider etwas später von der Schule nach Hause als geplant. Zwar nur 10 Minuten später. Aber diese 10 Minuten Verspätung verlängerte die Backzeit halt doch um 3,333 Prozent im Vergleich zu der im Rezeptbuch angegebenen Zeit (von ihm um das 10fache gedehnt). Indes: Die Enttäuschung über seinen ersten – und gleichzeitig missratenen – Kuchen hielt sich in Grenzen. Denn bereits auf dem Nachhauseweg beschlich ihn ein ungutes Gefühl, was seinen ersten selbst gebackenen Kuchen betraf. Nicht etwa, weil sein Kuchen den ganzen Nachmittag über still und heimlich im Backofen vor sich hin schlummerte, während unser Held in der Schule saß. Nicht etwa, weil die Großmutter von all dem nichts wusste. Nein, weil unser kleiner Held plötzlich einen rechnerischen Gedankenblitz hatte, der ihn ziemlich durcheinander brachte. Was, wenn man die Backzeit so ausdehnen würde, bis umgekehrt die Backtemperatur nur noch 1 Grad betrüge? Das würde konkret bedeuten, dass ein Kuchen, der 30 Minuten im 220 Grad heißen Ofen zu sein hatte, bei 1 Grad Backtemperatur einfach 220 Mal länger im Ofen zu sein hätte. Also für 110 Stunden. Warum hatten die Leute dann überhaupt noch Backöfen? Konnten sie nicht rechnen? Oder war es, weil ein Kuchen sich Dank des Backofens nach bereits einer ½ Stunde essen ließ? Hatte niemand die Geduld zu warten? Wobei: 110 Stunden auf einen Kuchen zu warten, war schon etwas lange. Schließlich waren dies ganze 4,5 Tage (inkl. der Nächte, wo man schlief, und vielleicht die Katze über den Kuchen herfiel, der Tag und Nacht auf dem Küchentisch sich quasi selbst buk).
Viele Jahre später, als er als 16-Jähriger die Lehre als Zuckerbäcker begann, bekam er eines Tages die alles klärende Antwort auf seine sehr interessante Frage, wie es ihn dünkte, nämlich auf das Backtemperatur-und-Backzeit-Verhältnis-Problem. Es gab da tatsächlich eine allumfassende Antwort, was das Verhältnis von Backtemperatur und Backzeit betraf. Die Antwort gliederte sich in 5 Teilantworten, die ihn ein Leben lang faszinierten – und von dem all die »Betty-Bossy-Bäcker« keine Ahnung hatten. Betty-Bossy-Bäcker, die stur nach Rezept vorgingen, aber nicht wirklich zu verstehen schienen, was Backen im Grunde – vom System her gesehen – bedeutete. Denn das Backen aller Arten von Kuchen unterlag immer 5 Grundgesetzen, was ein eigentliches Rezept hinfällig machte:
Читать дальше