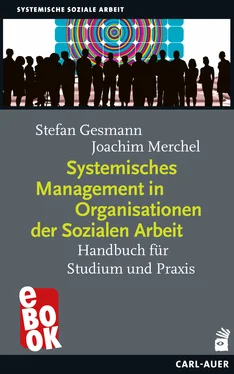Die Folge ist, dass soziale Dienstleistungen notwendigerweise inhomogen sind – und zwar auch in gewissen Grenzen innerhalb einer Organisation –, weil durch die Unsicherheit und durch die unverzichtbare aktive Mitwirkung von Individuen mit ihrem jeweiligen Eigensinn auch bei ähnlichen Zweckprogrammen jeweils unterschiedliche Dienstleistungen entstehen – was mit dem einen Leistungsadressaten gut funktioniert, kann mit dem nächsten wiederum ins Leere gehen oder gar gegenteilige Wirkungen erzeugen (Dunkel 2011, S. 188). Soziale Dienstleistungen müssen situativ und individuell konstituiert werden und sind daher nur begrenzt standardisierbar: am ehesten in ihren administrativen Rahmenbedingungen, kaum jedoch in ihrem interaktiven Kern. Bei »front-line organizations« (Smith, zit. nach Klatetzki 2010, S. 17), bei denen das Entscheidende in den vielfältigen Interaktionen zwischen dem »Frontpersonal« und den Leistungsadressaten geschieht, das für das Leitungspersonal nicht unmittelbar, sondern vor allem über Mitteilungen des Personals zugänglich ist, sind die wesentlichen Handlungsmodalitäten bei der Leistungserstellung nur begrenzt und kaum intentional durch Managementhandeln steuerbar. Zentrale Vorgaben, z. B. über Standardisierungen mit entsprechenden Verhaltensvorschriften, stoßen an Grenzen gegenüber den sich jeweils immer wieder neu ergebenden und zu bewältigenden Situationsanforderungen, die in Abstimmungsprozessen bearbeitet werden müssen. Dies erfordert insgesamt einen Steuerungsmodus, bei dem die untere Hierarchieebene wegen ihrer Problemwahrnehmungs- und Problembearbeitungsnähe eine große Bedeutung einnimmt und die beim Management daher einbezogen werden muss.
Die zentrale Stellung nimmt das Personal ein, das durch entsprechende Maßnahmen des Personalmanagements eingeworben, qualifiziert und kompetent gehalten sowie an die Organisation gebunden werden muss: Die Leistungsfähigkeit der Organisation hängt wesentlich ab von einem Personalstamm an »Arbeitskräften, die ihre Tätigkeit wissenschaftlich, vergleichsweise autonom und im Rekurs auf einen besonderen ethischen Kontext« ausübt (I. Bode 2012, S. 153). Umgekehrt muss die Organisation »ein gewisses Maß an Vertrauen in die Kompetenzen der (angestellten) Mitglieder und in den Berufsethos der zentralen Funktionsträger« aufbauen (ebd., S. 157). Dabei darf ein solches Vertrauen nicht blind proklamiert werden, sondern muss auf einer Basis der von der Organisation geprüften und kontinuierlich entwickelten Kompetenz und Motivation des Fachpersonals (»Personalentwicklung«) erfolgen.
2.3Legitimation sozialer Dienstleistungsorganisationen
Die politische Konstituierung sozialer Dienstleistungen und die Eingebundenheit in einen sozialstaatlichen Rahmen, der mit Begriffen wie ›soziale Hilfe‹, ›Chancengerechtigkeit‹, ›Gewährleistung eines menschenwürdigen Lebens‹, ›gesellschaftliche Integration‹ etc. normativ aufgeladen ist, haben zur Folge, dass die Organisationen Sozialer Arbeit sich in besonderer Weise politisch und normativ als Organisationen legitimieren müssen. Sie müssen sich als von gesellschaftlichen und (sozial)politischen Entscheidungen unmittelbar abhängige Organisationen legitimieren
•über die Art ihrer Leistungserstellung (Prozesse);
•über die Effekte der von ihnen erbrachten Leistungen, wobei diese Effekte zum einen auf die Verbesserung der Lebenssituation ihrer Leistungsadressaten und auf die Erfolge der in die sozialen Hilfen eingewebten Kontrollaktivitäten bezogen sind, aber zum anderen auch darüber hinausgehen, denn es geht auch um Effekte hinsichtlich der geforderten Integrationsleistungen für das gesellschaftliche Zusammenleben (u. a. Aktivierung gesellschaftlichen Engagements und Zusammenhalts, Vermittlung und Stabilisierung von Solidaritätsnormen, Erzeugen persönlicher Nähe u. a. m.);
•über die Darlegung von Prozessen und Effekten eines organisationsinternen Managements, das dem normativen Rahmen, in den die Organisation eingebettet ist, entspricht (»Corporate Governance«; Schuhen 2014).
Organisationen der Sozialen Arbeit sind aufgrund ihrer spezifischen gesellschaftlichen und politischen Umweltkonstellationen gefordert, im Hinblick auf unterschiedliche Interessenträger und hinsichtlich dieser drei Faktorenbündel Legitimation zu erzeugen und aufrechtzuerhalten sowie dadurch die eigene Organisation mit einem tragfähigen Vertrauenspotenzial ihrer Umwelt auszustatten. Die besondere Angewiesenheit sozialer Dienstleistungsorganisationen auf die Legitimation gegenüber ihrer Umwelt macht auf zwei für das Management relevante Mechanismen aufmerksam:
• Kongruenz zwischen Außendarstellung und Innenleben der Organisation: Organisationen der Sozialen Arbeit müssen in besonderer Weise Wert legen auf das, was Kühl die »Schauseite« der Organisation nennt (Kühl 2011, S. 136 ff.): Das Schaufenster, in dem die Organisation von außen betrachtet werden kann, darf nicht vernachlässigt werden. Zwischen der nach außen gerichteten Fassade, mit der zu Legitimationszwecken ein Bild von der Organisation gezeichnet und vermittelt wird, und der in der Organisation wahrnehmbaren Realität wird in der Regel keine vollständige Deckungsgleichheit herrschen. Jedoch muss die Organisation bemüht sein, die Entkoppelung von Fassade und realer Erlebbarkeit nicht allzu groß werden zu lassen. Denn wenn die relevanten Akteure aus der Umwelt die Fassade als »scheinheilig« (ebd.) erkennen, verliert das Schaufenster drastisch an Legitimationspotenzial. Insofern muss das Management für ein legitimationsfähiges Schaufenster sorgen und darauf auch entsprechende Sorgfalt aufwenden. Doch der Nutzen schöner Fassaden (u. a. Verbergen interner Konflikte und Unzulänglichkeiten, Ausbalancieren widersprüchlicher Anforderungen) darf nicht so in den Mittelpunkt rücken und damit »überzogen« werden, dass die Kommunikationsangebote des Schaufensters sich als nicht mehr ausreichend anschlussfähig erweisen an das wahrnehmbare Geschehen in der Organisation. Die Folge wäre ein Verfall von Glaubwürdigkeit, also das genaue Gegenteil der mit dem schönen Schaufenster beabsichtigten Legitimation.
• Legitimität über Verarbeitung von Erwartungen der Umwelt: Organisationen der Sozialen Arbeit müssen besonders sensibel diejenigen an sie gerichteten Anforderungen wahrnehmen und im Hinblick auf Markierungen für das Management interpretieren, die in dem jeweiligen gesellschaftlichen Sektor explizit formuliert und implizit kommuniziert werden, dem sie angehören. Sie müssen ihre inneren Strukturen und Verfahrensweisen nicht allein im Hinblick auf eine innere Systemdynamik interpretieren und herausbilden, sondern diese gleichermaßen konzipieren in der Verarbeitung von »Ansprüchen und Erwartungen seitens der institutionalisierten Umwelt« (Drepper 2010, S. 138). Das Erzeugen von Legitimität über die Aufnahme von spezifischen Handlungserwartungen der Umwelt wird ein zentrales Motiv für Organisationshandeln und Strukturbildung. Dabei muss nicht jedes Organisationshandeln einer internen Handlungslogik entsprechen. Organisationsprogramme können vielmehr mit dem übrigen Organisationsgeschehen lediglich lose verkoppelt sein; sie werden dann auf eine Art in das Organisationsgeschehen hineingenommen, dass sie intern »zumindest nicht allzu sehr stören«, aber nach außen eine Übereinstimmung mit Erwartungen aus der Umwelt signalisieren und daher legitimationsbedeutsam sind. Ein Beispiel ist hier »Qualitätsmanagement«: Der hohen legitimatorischen Bedeutung der Qualitätsformel und der damit einhergehenden Anforderung, »Qualitätsmanagement« zu betreiben, kann sich kaum eine Organisation der Sozialen Arbeit entziehen. Sie ist also legitimatorisch zur Übernahme dieser Anforderung verpflichtet; ob, in welcher Weise und Intensität aber intern Prozesse des Qualitätsmanagements realisiert werden, bleibt mit der Übernahme der Legitimationsanforderung höchst unklar und führt zu erheblichen Unterschieden, wie ein Blick in verschiedene Organisationen der Sozialen Arbeit zeigt. Die Anpassung an Regeln, die im jeweiligen organisationalen Sektor oder Umfeld institutionalisiert sind, beeinflusst das Entscheidungsverhalten der Organisation im Hinblick auf Ziele, Mittel, Theorieverwendung, Methodenkonstruktion etc. und sorgt für eine Angleichung an die Bedingungen und Erwartungen im institutionalisierten Feld. Das führt einerseits zu Phänomenen des » Isomorphismus « (Drepper 2010, S. 139 f.): Die Organisationen im Feld werden einander ähnlicher. Dadurch gewinnen sie andererseits wieder an Legitimität, da sie sich nicht nur über die Aspekte »Effektivität« und »Wirtschaftlichkeit« legitimieren können, sondern gleichermaßen über die »Aufnahme institutionalisierter Erwartungen, sichtbar in der Ähnlichkeit zu anderen Organisationen«, indem also die Kommunizierbarkeit der Vorgänge und Strukturen in der Organisation anschlussfähig gemacht werden an die Relevanzkriterien in der Umwelt. Ein Beispiel für solche Phänomene des Isomorphismus sind die Normen, die für Fallbearbeitungen in Jugendämtern (bzw. im Allgemeinen Sozialen Dienst, ASD) bestehen: Kaum ein ASD-Team kann es sich ohne Legitimationsverlust noch leisten, keine kollegiale Beratung durchzuführen, dabei kein Genogramm anzuwenden, nicht nach Ressourcen im sozialen Umfeld des Klienten (»Sozialraum«) gefragt zu haben, keine Form von »sozialpädagogischer Diagnostik« auf dem Arbeitsplan zu haben. Die Übernahme institutionalisierter Erwartungen aus der Umwelt und die Angleichung von Organisationen (»Isomorphismus«) bedeutet keinen Profilverlust der jeweiligen Organisation. Sie verarbeiten die aus der Umwelt entnommenen »Vorlagen« für ihre Strukturbildung (staatliche Vorgaben, Professionsstandards, Strukturmodelle vergleichbarer Organisationen, theoretische und methodische Entwicklungsimpulse und Anforderungen etc.) in einer organisationsspezifischen Weise, die den in der jeweiligen Organisation herausgebildeten Gegebenheiten und Dynamiken, ihrer jeweiligen Entstehungsgeschichte und Organisationslogik entspricht (Drepper u. Tacke 2010, S. 255).
Читать дальше