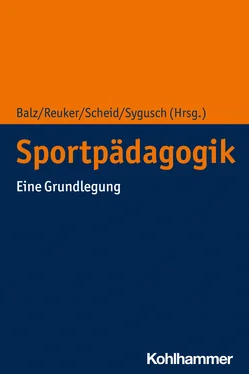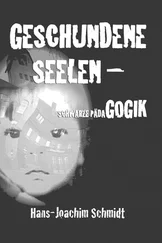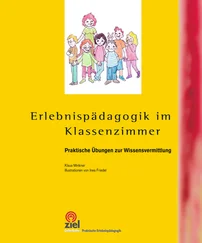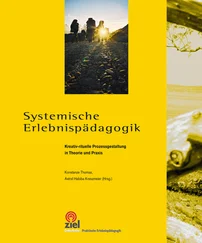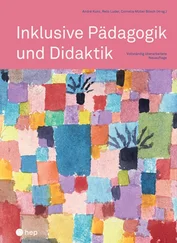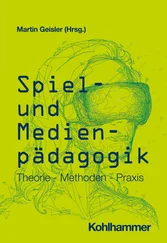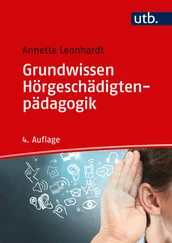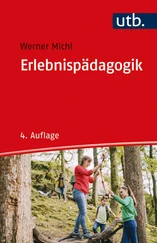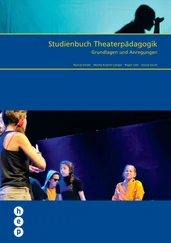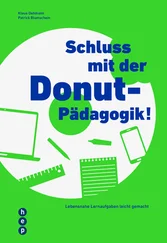Jenseits dieser grundlegenden Forschungsparadigmen lassen sich in Anlehnung an König (2020, S. 56–58) folgende Subdisziplinen bzw. disziplinorientierte Zugangsweisen der Sportpädagogik erkennen (u. a. auch Scherler, 1992):
• Die Historische Sportpädagogik beschäftigt sich mit der Geschichte von Leibesübungen und Sport, die im Wesentlichen mit der oben dargestellten problemgeschichtlichen Perspektive der Sportpädagogik korreliert, d. h., sie unterscheidet sich von der Sportgeschichte durch ihre spezifische pädagogische Sichtweise (z. B. Krüger, 2019).
• Im Unterschied dazu geht es in der Systematischen Sportpädagogik um einen gegenwartsbezogenen Erkenntnisgewinn. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Fragen zur wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Ausrichtung sowie zur methodologischen Orientierung der Sportpädagogik (Scherler, 1992, S. 164).
• Ziel der Vergleichenden Sportpädagogik ist es, den Stellenwert der Bewegungs- und Sportkultur in der Erziehung über Deutschland hinaus in international vergleichender Absicht zu betrachten (z. B. Haag, 2010).
• In der Anthropologischen Sportpädagogik werden anthropologische Grundannahmen und Themen wie Körper, Bewegung, Gesundheit, Spiel und Leistung im Zusammenhang mit Bewegung, Spiel und Sport behandelt (Grupe, 1984). Hierbei geht es primär um den Menschen in seinen Bezügen zu und Entwicklungsmöglichkeiten durch Bewegung, Spiel und Sport, die immer auch gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Gegebenheiten und Wandlungen unterliegen (König, 2020, S. 57).
• Die Schulsport-Pädagogik befasst sich mit Bildungs- und Erziehungsfragen von Bewegung, Spiel und Sport in der Schule. Sie weist damit eine besondere Nähe zur Schulpädagogik und Sportdidaktik auf (ebd.). Während es für Lange (2014, S. 6–7) im Blick auf den Schulsport keinen Unterschied zwischen Sportpädagogik (oder Schulsport-Pädagogik) und Sportdidaktik gibt, sehen Prohl und Scheid (2017, S. 11) Sportdidaktik als »angewandte Sportpädagogik«, in der vornehmlich die Was- und Wie-Fragen, d. h. Inhalts- und Vermittlungsfragen, diskutiert werden. Demgegenüber werden Warum- und Wozu-Fragen, also Sinn- und Begründungsfragen, in analytischer Trennung primär von der Sportpädagogik geklärt (ebd.). Ungeachtet der jeweiligen Standortbestimmung stehen Sportpädagogik und Sportdidaktik in enger Beziehung zueinander, weil Ziel-, Inhalts- und Methodenfragen in einem Interdependenzzusammenhang stehen und nicht unabhängig voneinander diskutiert werden können. In diesem Sinne bezeichnen Balz und Kuhlmann (2003, S. 26) Sportdidaktik auch als »schulbezogene Sportpädagogik«. Insbesondere im Blick auf die Sportlehrer*innenbildung in Lehramtsstudiengängen wird die Sportdidaktik traditionell als zentrales Teilgebiet der Sportpädagogik bestimmt (u. a. Größing, 2003, S. 509; Prohl & Scheid, 2017, S. 11).
• Bereits die Bezeichnung Außerschulische Sportpädagogik weist darauf hin, dass die wissenschaftliche Betrachtung von Bildung und Erziehung im Handlungsfeld der Bewegungs- und Sportkultur an Orten außerhalb der Schule erfolgt. Wenngleich »die pädagogische Dimension nicht die Hauptursache des außerschulischen Sports ausmacht, öffnet sich trotz alledem dieses Handlungsfeld pädagogischen Interpretationen und Untersuchungen […]« (Meinberg, 1996, S. 47). Im Sinne eines »Sports für alle« gewinnt sie angesichts gesellschaftlicher Differenzierungen zunehmend an Bedeutung, wie z. B. Überlegungen und Studien zum Kinder- und Jugend-, Behinderten- oder Alterssport zeigen (dazu König, 2020, S. 57–58; Thiele, 2018, S. 4–6).
3.5 Zur Systematik der Erkenntnisgewinnung
Welche Formen der Erkenntnisgewinnung gibt es in der Sportpädagogik? Welche Entwicklungen lassen sich im Umgang mit Forschungsmethoden feststellen? Beschreibungen zu Formen der Erkenntnisgewinnung und zum grundlegenden Erkenntnisinteresse gehören zum Selbstverständnis einer jeden Wissenschaft. Dies ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil Methoden den Untersuchungsgegenstand in bestimmter Weise vorformatieren und damit zugleich für ein spezifisches Welt- und Menschenbild stehen (u. a. Meinberg, 1993a, S. 14).
So hat die Sportpädagogik – wie auch andere Teilgebiete der Sportwissenschaft – keine eigenständigen Forschungsmethoden und -ansätze entwickelt. Sie greift vielmehr auf das vorhandene Instrumentarium wissenschaftlicher Methoden und Verfahrensweisen zurück, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften insgesamt üblich und verbreitet sind (u. a. Balz & Kuhlmann, 2003, S. 51; Stibbe, 2017, S. 22). Gemäß der jeweiligen Denktradition lassen sich hierbei vereinfachend zwei unterschiedliche Forschungsparadigmen erkennen (König, 2020, S. 65). Im Vordergrund der theoretisch-systematischen Ausrichtung der Sportpädagogik, die an Denk- und Verfahrensweisen in der Tradition der geisteswissenschaftlich orientierten Pädagogik anknüpft, stehen hermeneutische Verfahren der Erkenntnisgewinnung. Damit werden im Sinne der Kunst des Verstehens idealtypisch Texte ausgelegt, Lehrer-Schüler-Interaktionen interpretiert oder institutionelle Strukturen offengelegt (Meinberg, 1993b; Scheid & Wegner, 2001, S. 110). Demgegenüber wird in der empirisch-analytischen Sportpädagogik, in der es um die erfahrungswissenschaftliche Beschreibung der Erziehungswirklichkeit in sportlichen Settings geht, auf das methodische Repertoire der Sozial- und Verhaltenswissenschaften rekurriert und mit quantitativen, qualitativen oder verknüpfenden Mixed-Methods-Forschungsansätzen gearbeitet (König, 2020, S. 67–68; u. a. Ansätze und Methoden in Aschebrock & Stibbe, 2017; Kuhlmann & Balz, 2005).
3.6 Ausblick: Sportpädagogik – Grenzen und Herausforderungen
Wo liegen die Grenzen der Sportpädagogik? Welche Herausforderungen ergeben sich für die Sportpädagogik als Wissenschaftsdisziplin? Kennzeichen der Sportpädagogik ist es, sich mit der pädagogischen Handlungspraxis in verschiedenen sportlichen Settings wie auch – als Wissenschaft – mit der normativen Grundlegung, Erforschung und Reflexion dieses Handelns zu beschäftigen (Krüger, 2019, S. 20; König, 2020, S. 70–72). Vor diesem Hintergrund lassen sich abschließend einige Grenzen und Herausforderungen aufzeigen, die das Selbstverständnis der Sportpädagogik im Blick auf ihr Verhältnis zur sportlichen Handlungspraxis einerseits und auf die wissenschaftliche Profilierung als Teilgebiet der Sportwissenschaft andererseits betreffen.
Wenn sich Sportpädagogik auch als Beratungswissenschaft für die sportliche Praxis versteht, ist ihre Leistung auch danach zu beurteilen, inwieweit es bislang gelungen ist, diese anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen (Prohl, 2010, S. 355). Blickt man in diesem Zusammenhang z. B. auf Transferleistungen der Sportpädagogik für die Schulsportpraxis, ist das Ergebnis eher ernüchternd. So hält Stibbe (2017) für die Entwicklung und Implementation von Lehrplänen fest, dass die Sportpädagogik nur selten von den dafür zuständigen Ministerien als wissenschaftliche Beratungsinstanz für curriculare Fragen herangezogen wird. Lehrplanevaluationen und wissenschaftlich fundierte Strategien zur Lehrplanentwicklung erfolgen offenbar nur in wenigen Ländern (ebd., S. 23). Ähnliches gilt auch für den Bereich des Leistungssports: Obgleich sportpädagogische Inhalte inzwischen in der Übungsleiter- und Trainerausbildung angekommen sind, bleibt zu resümieren, dass Forschungserkenntnisse und Empfehlungen meist nur dann aufgenommen werden, wenn sie »für das Erringen von Siegen« im Leistungssport hilfreich erscheinen (König, 2020, S. 72). Eine »Pädagogik des Leistungssports« (Prohl & Lange, 2004) und kritische(re-)empirische Befunde zur Nachwuchsförderung (Creutzburg & Scheid, 2014; Pallesen, 2014) erweisen sich für die Praxis wohl eher als irritierend. Allgemein bleibt es eine wesentliche Aufgabe der Sportpädagogik, sich für eine Sportentwicklung in pädagogischer Absicht einzusetzen, zumal »das humane Interesse zunehmend von sportiven, medialen und ökonomischen Interessen überlagert wird« (Balz & Kuhlmann, 2003, S. 42).
Читать дальше