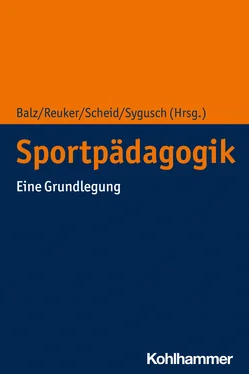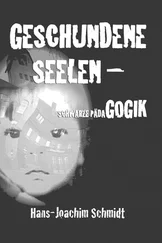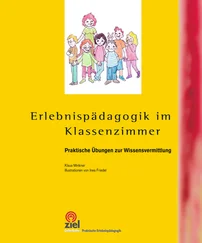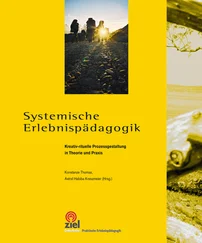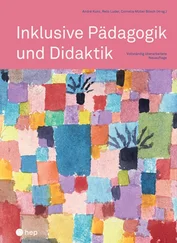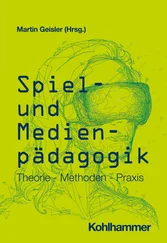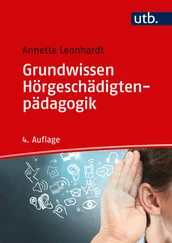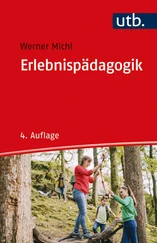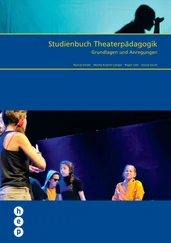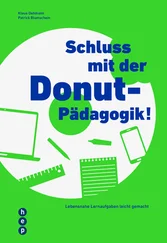Schaut man sich (neuere) vorliegende Systematiken mit möglichen Arbeitsgebieten der Sportpädagogik unterhalb der Prohlschen Trias an, dann gehen diese in aller Regel selbst systemisch vor, in dem sie Domänen benennen, die als mögliche Arbeitsgebiete (synonym Handlungsfelder) der Sportpädagogik gelten können. Um der Gefahr der Verletzung der Vollständigkeit an Arbeitsgebieten in systematischer Absicht zu begegnen, bedient man sich oftmals insofern einer Hilfskonstruktion, als selbst in grafischen Darstellungen mit Hinweisen wie »etc.« oder »…« grundsätzlich Ergänzungen von (fehlenden und/oder zukünftig neuen) Arbeitsfeldern vorgenommen werden können (z. B. Balz & Kuhlmann, 2003, S. 27). Während z. B. Haag und Hummel (2001, S. 366–460) in ihrem Handbuch zur Sportpädagogik noch eine personalisierte Systematik nach Zielgruppen im Lebenslauf bevorzugen, identifiziert z. B. König (2013, S. 66–68) Schulsport, Breitensport und Spitzensport als wesentliche Themenfelder und Forschungsschwerpunkte. Diese drei Arbeitsgebiete bilden demnach semantisch das sportbezogene Äquivalent zu dem sport-neutralen Begriffstrio von Prohl oben.
Eine ganz andere (systematische) Betrachtungsweise ergibt sich, wenn man nicht den Sport als Ausgangspunkt nimmt, um daraus systematisch Arbeitsgebiete zu erfassen, sondern selbstreferenziell in Anschlag bringt, was denn den Arbeitsbereich Sportpädagogik ausmacht, wie er sich als etablierte universitäre Arbeitseinheit systematisch beschreiben lässt. Welches besondere Profil kann die Sportpädagogik innerhalb der Fakultäten und Institute für Sportwissenschaft an den Hochschulen für sich in Anspruch nehmen? Wo liegen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu anderen Arbeitsbereichen bzw. Teildisziplinen der Sportwissenschaft? Der Frage nach dem »Kern« des Arbeitsbereichs Sportpädagogik widmet sich z. B. der neuere Band von Balz (2019), bezogen auf den speziellen Arbeitsbereich in Wuppertal, den er (gemäß Gliederung des Inhaltsverzeichnisses) mit vier (typischen?) Arbeitsgebieten profiliert: in (1.) Normative Sportpädagogik (im Sinne von Planungsdidaktik), in (2.) Empirische Sportpädagogik (im Sinne von Bildungsforschung), in (3.) (Kommunal-) Politische Sportpädagogik (im Sinne von Sportentwicklung) und in (4.) Vermittelnde Sportpädagogik (z. B. im Sinne von Lehrerbildung).
Diese Systematik korrespondiert einerseits mit den Aufgaben von Forschen und Lehren, macht aber andererseits deutlich, dass die Sportpädagogik im Gegensatz zu anderen Teildisziplinen der Sportwissenschaft zu einer »gesellschaftlich engagierten Sportpädagogik« (ebd., S. 7) reifen kann, sobald sie (eben: sportpädagogisch imprägniert) die Aufgabe wahrnimmt, »sich an konkreten Projekten zur Sportentwicklung kooperativ zu beteiligen bzw. solche selbst (vor Ort) zu initiieren« (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 91). Das können Vorhaben »etwa zur innovativen Vereinsentwicklung, zu informellen Sportszenen, zur Dopingbekämpfung im Spitzensport oder zur inklusiven Schulsportentwicklung« (ebd., S. 91) sein (vgl. dazu auch die »Projekte aus deutschen Quartieren« von Balz & Kuhlmann, 2015). Die Beispiele aus den Arbeitsgebieten der Sportpädagogik erweisen sich als anschlussfähig sowohl für die Dreigliederung von Prohl (2013) mit Schule, Freizeit und Leistungsbereich als auch von König (2013) mit Schulsport, Breitensport und Spitzensport.
3.4 Zur Systematik der Betrachtungs- und Zugangsweisen
Wie lassen sich wissenschaftliche Betrachtungs- und Zugangsweisen in der Sportpädagogik ordnen? Welche grundlegenden Forschungsansätze können in der Sportpädagogik ausgemacht werden? Beim Blick auf vorliegende Systematisierungen zu Forschungszugängen und Betrachtungsweisen innerhalb der Sportpädagogik, fällt auf, dass es keine nach einheitlichen Systematisierungskriterien geordnete Vorstellung darüber gibt, sondern eher pragmatische Aufzählungen wissenschaftlich-disziplinorientierter Herangehensweisen im Vordergrund stehen (Meinberg 1996, S. 45). Während z. B. Meinberg (1996) zwischen einer »Histeriographie der Sportpädagogik«, »pädagogischen Theorien« des schulischen und außerschulischen Sports inklusive des Spiels und der »vergleichenden Sportpädagogik« unterscheidet (ebd., S. 45–47), greifen Grupe und Krüger (2007) auf eine Systematisierung von Schmitz (1979, S. 65) zurück, in der die Sportpädagogik nach »anwendungsorientierten« Zugängen wie Schulsport, Vereinssport, Seniorensport, Gesundheitssport usf. und »disziplinorientierten« Ausrichtungen wie historisch, systematisch, anthropologisch usf. gegliedert wird. Demgegenüber wird in neueren Überblicksbeiträgen zwischen grundlegenden wissenschaftlichen Betrachtungsweisen und Subdisziplinen der Sportpädagogik differenziert (König, 2020, S. 55–58).
So geht Prohl (2010) von drei wissenschaftlichen Zugangsweisen in der Sportpädagogik aus, die er als problemgeschichtlich, bildungstheoretisch und erziehungswissenschaftlich bezeichnet (ebd., S. 344). In der problemgeschichtlichen Betrachtungsweise der Sportpädagogik geht es darum, Ideen und Konzepte der Leibeserziehung und des Sports in der historischen Entwicklung von Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport nachzuzeichnen, indem insbesondere die Bedeutung von Leiblichkeit und Bewegung zwischen individuellen und gesellschaftlichen Anforderungen in der Erziehung diskutiert werden (ebd.; Neuber et al., 2013, S. 407–416; ausführlich Krüger, 2019). Die bildungswissenschaftliche Perspektive der Sportpädagogik beschäftigt sich mit Fragen von Bildung und Erziehung in der Bewegungs- und Sportkultur. Sie steht in enger Verbindung mit der geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Pädagogik und entwickelt auf einer normativen Basis Sollensvorstellungen für sportpädagogisches Handeln in verschiedenen Settings der Lebensspanne, die idealtypisch auch für Beratungsleistungen genutzt werden (Prohl, 2010, S. 18; z. B. Ruin & Stibbe, 2020). Die erziehungswissenschaftliche Sichtweise setzt sich schließlich mit empirischen Tatsachen »über die Mittel, Wege und Hindernisse« zur Realisierung von Bildungszielen in der Erziehungswirklichkeit der Bewegungs- und Sportkultur auseinander (Prohl, 2010, S. 18; Hervorhebungen i. Orig.). Diese erfahrungswissenschaftliche Forschung steht allerdings immer in einem bildungstheoretischen Kontext. Damit erweist sich die Sportpädagogik als ein sportwissenschaftliches Teilgebiet zwischen Sollen und Sein (ebd.), das sich einerseits als bildungstheoretisch-normative bzw. theoretisch-systematische Sportpädagogik und andererseits als empirisch-analytische Sportpädagogik versteht (Balz, 2009; Neuber et al., 2013, S. 428; Krüger, 2019, S. 31–33).
Die besondere Verbindung von normativen und empirisch-analytischen Zugangsweisen, die in den Horizont bildungstheoretischer Fragen nach dem Wozu und Warum eingebettet sind, kann gewiss als wesentliches Merkmal der Sportpädagogik im Vergleich zu anderen sportwissenschaftlichen Disziplinen angesehen werden. Sie zeichnet sich durch ein pädagogisch-humanes Interesse oder eine pädagogische Orientierung aus (Kurz, 2017). In diesem Zusammenhang ist es eine wichtige Aufgabe der Sportpädagogik, Erkenntnisse und praktische Implikationen kritisch im Blick auf das pädagogische Interesse zu prüfen (ebd., S. 213). Dies bedeutet, dass das Aufspüren und die Reflexion des zugrunde gelegten, meist impliziten Menschenbildes von besonderer Bedeutung ist, weil die »beiden für die Erziehungspraxis […] zentralen Kategorien der Bildungsziele und der Erziehungsmaßnahmen […] unweigerlich davon beeinflusst [werden]« (Prohl, 2010, S. 14; ähnlich Prohl, 2013, S. 13–14). So gilt es, eine »reflexive Verknüpfung« von Normativem und Empirischem zu leisten, weil sich aus empirischen Fakten keine »wünschenswerte[n] Normen« ableiten wie sich auch umgekehrt aus normativen Orientierungen keine empirischen Tatsachen folgern lassen (Balz, 2009, S. 7).
Читать дальше