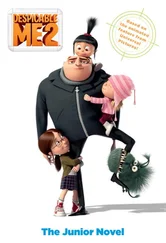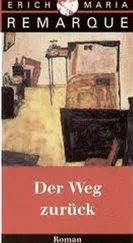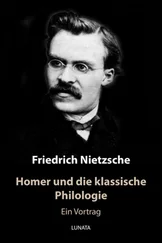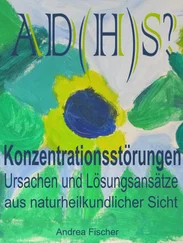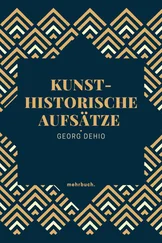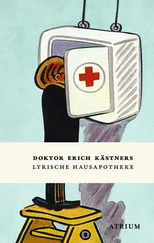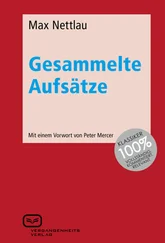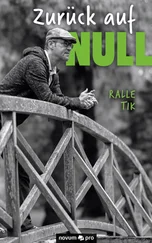So vergleicht er PetroniusPetronius mit Gregor von ToursGregor v. Tours:5 jener ein «gebildeter und großer Herr, der seinesgleichen mit allem Raffinement eine Posse vorführt», dieser hat nichts anderes zur Verfügung als «sein … schülerhaft gewordenes Latein; er hat keine Register, die er ziehen, kein Publikum, auf das er mit einer ungewohnten Würze, einer neuen Stilvariante wirken könnte». Oder es wird aus der Tatsache, daß keine grundsätzlichen Verschiedenheiten im Bildungsstand der Laienbevölkerung bestanden, auf den «volkstümlichen» Charakter der Chansons de geste Chanson de geste geschlossen: «Diese Dichtung handelt zwar ausschließlich von den Taten der feudalen Oberschicht, aber sie wendet sich ohne Zweifel an das Volk.» Umgekehrt konnte das Ideal des höfischen RomansRoman (höfischer), in dem «das Funktionelle, geschichtlich Wirkliche des Standes verschwiegen wird», sich ganz verschiedenen Lagen, ganz verschiedenen Zeiten anpassen. Und im Decamerone gestaltet sich die wahre Geselligkeit dank einer Fülle von Beziehungen, die an das entsprechende antike Genus, an den antiken Liebesroman, die fabula milesiaca Fabula milesiaca erinnert. In allen Anregungen liegt eine Wechselwirkung vor, das bel parlare zieht den Hörenden in Mitleidenschaft und wirkt zurück auf den Erzähler. «Das ist nicht verwunderlich», bemerkt Auerbach, «da die Einstellung des Schriftstellers zu seinem Gegenstand, und die Publikumsschicht, für die das Werk bestimmt ist, sich in beiden Epochen ziemlich genau entsprechen». Wiederum ist RabelaisRabelais, F. zwar «volkstümlich», «da man jederzeit einem ungebildeten Publikum, sofern es seine Sprache versteht, mit seinen Geschichten große Freude machen kann, aber die eigentlichen Adressaten seines Werkes sind die Angehörigen einer geistigen Elite, nicht das Volk». Nicht jenes Volk, an das sich die reformatorische Publizistik gewandt hat, die sich stets – so in Theodore de BèzeBèze, Th. de – von den façons esloignées du commun der Humanisten distanziert hat. MontaigneMontaigne, M. de ist schließlich der erste Schriftsteller, der für eine Schicht von Gebildeten schrieb, die die fachliche Spezialisierung perhorreszierten und sich auch beruflich nicht festlegen wollten – «an dem Erfolg der Essais erwies das gebildete Publikum zum ersten Mal seine Existenz. Montaigne schreibt nicht für einen bestimmten Stand, nicht für ein bestimmtes Fachgebiet, nicht für ,das Volk‘, nicht für die Christen; er schreibt für keine Partei; er fühlt sich nicht als Dichter: er schreibt das erste Buch der laienhaften Selbstbesinnung, und siehe da, es gab Menschen, Männer und Frauen, die sich als Adressaten empfanden.» Wir erkennen schon an diesen Beispielen die Fruchtbarkeit des Prinzips, das die Wechselwirkung von Autor und Leser ins Auge faßt und zugleich den möglichen dialektischen Charakter des Publikumsbegriffes: wir können auf ein volkstümliches, ein ständisch bestimmtes Publikum treffen, aber auch auf ein Publikum, das erst entsteht dank der persönlichen und schriftstellerischen Wirkung eines Autors, der ein neues Lebensideal ausspricht. Doch auch im elisabethanischen Theater des 16. Jahrhunderts enthüllt sich, daß Stoffe aus allen Ländern den Stimmungsreiz des Fremden für das englische Publikum um 1600 enthielten. Die Poesie zog dank dem schon dem 6. Jahrhundert eigentümlichen «hohen Maß von perspektivisch-historischem Bewußtsein» die verschiedensten Kräfte und Regionen an sich, die entgegengesetzten Welten von Ideen drängten sich in die Phantasie der Dichter. Unter solchen Bedingungen stand das antike Theater nicht. «Der Kreis seiner Gegenstände war zu beschränkt, weil das antike Publikum andere Kultur- und Lebenskreise als den eigenen nicht als gleichwertig und nicht als beachtenswerten künstlerischen Gegenstand ansah.» Die poetische Phantasie kann in ihren Strom aufnehmen, was dem Geschmack einer Zeit, einer Gesellschaft entspricht oder Töne eines elementaren Empfindungslebens, Formen des Ausdrucks finden, die, unzeitgemäß zunächst, erst in einer späteren Generation auf ein aufnahmefähiges Publikum treffen. Wenn sich Autor und Publikum nur in der Peripherie ihres Wesens anziehen, eine neue Kunst des Anschauens und Gestaltens erst im Zug einer späteren Entwicklung verwirklicht wird, dann mischt sich in den Flug der Phantasie vieler Schriftsteller des 19. Jahrhunderts der unbezwingliche Haß gegen die Verständnislosigkeit des Publikums – bei StendhalStendhal, H., Baudelaire, den GoncourtsGoncourt, E. u. J..6 Ihre kritische Stimmung haben spätere Generationen in sich aufgenommen und in Einsichten, in unzeitgemäßen Betrachtungen, in kritischen Analysen ihrer Gegenwart verdeutlicht. Stendhal dachte nur an die happy few , KierkegaardKierkegaard nur an jenen Einzelnen, den er «mit Freude und Dankbarkeit seinen Leser nannte». Diese Seite eines systematischen Widerspruchs gegen die Zeit wurde bis heute auf die mannigfachste Weise beleuchtet und fortgeführt, aber seine Grundlinien an keinem Punkte ausgelöscht.
Auerbachs Gesichtspunkt, das heißt die Frage nach dem Verhältnis von Autor und Publikum, den wir, ihn etwas ergänzend, beschrieben haben, leitete aber zu einer Reihe von neuen Fragen, denen das Dantebuch schon präludierte, und die in zahlreichen Aufsätzen zur Divina Commedia sowie in seinem letzten Buch über Literatursprache und Publikum zu einer organischen Fortsetzung führten. Hier fand er den Leitfaden für die Erweiterung seiner Einsicht. Ob er DantesDante Anreden an den Leser analysiert und zeigt, wie sie als eine Form christlicher Beschwörung sich von der antiken ApostropheApostrophe unterscheiden, ob er in einem Vergleich der Camillaepisode aus VergilVergil mit dem entsprechenden Stück des hundertfünfzig Jahre späteren altfranzösischen Enéas zugleich Wandlungen des hohen Stils und die veränderte Gesellschaftsschicht im Auge hat, an die sich der mittelalterliche Dichter wendet, wenn er die OvidscheOvid Liebeskasuistik aufnimmt – überall ist der Ton angeschlagen, der vielfach weiterklingt in dem kühnen Entwurf über das abendländische Publikum und seine Sprache, in dem umfassende Gesichtspunkte hervortreten: Struktur des römischen Publikums, und – als die nationalen Sprachen ihre Selbständigkeit gegenüber dem Latein erlangt hatten – Entstehung einer neuen Gesellschaftsschicht, die auch durch eine bestimmte Summe literarischer Anschauungen und Gefühle bestimmt war. Die Analyse führt zu dem Punkt, an dem der mächtige Schatten der auseinandergleitenden antiken Welt schwindet und die lateinische Literatur aufhört «antikisch zu sein», dafür aber mit vielen Fasern in die werdenden Vulgärsprachen hineinragt, von denen sie erst seit der karolingischen Reform sich wieder zu lösen beginnt. Es ist eine Übergangszeit, in der die stilumbildende Kraft des spätantiken und frühmittelalterlichen Lateins und der Vulgärsprachen einen neuartigen Ausdruck geschaffen hat und in der das In-, Neben- und Durcheinander vieler Formen zu immer neuen Formulierungen führt. Doch erst als sich wieder eine Minorität von Gebildeten mit eigenem Pulsschlag und oft auch mit realer Organisation findet, ist nach einer Jahrhunderte währenden Pause, in der das Latein Sondersprache der Liturgie und der Kanzleien war, wieder eine Gesittung erreicht, die sich mit der antiken vergleichen läßt. Auerbachs soziologische Frage nach Zusammensetzung und Funktion des Publikums verschiedener Epochen trifft stets mit einer stilkritischen zusammen. Wieviel Verständnis er im Umkreis der Dichtung zeigt, ist bekannt: schon in dem Dantebuch hat er in einer sich stets auf gleicher Höhe haltenden Diktion entdeckt, wie das poetische und individuelle Moment der vita nuova das Konventionelle des dolce stil nuovoDolce stil nuovo überwiegt; sein feines Ohr, seine künstlerische Empfänglichkeit vernahmen den zauberhaften, verborgenen Ton von DantesDante Jugendgedicht.
Читать дальше