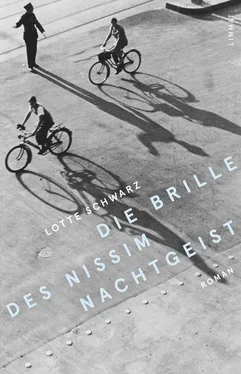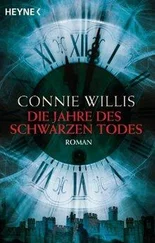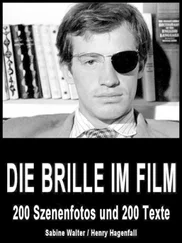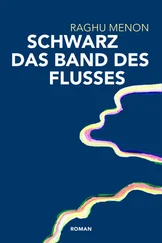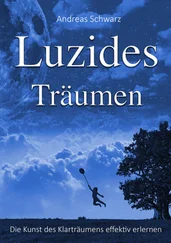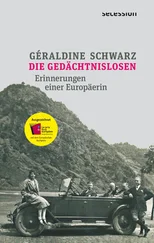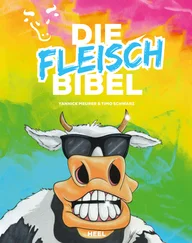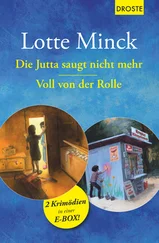Von Signora Teresa erfuhr ich, dass Herr Paksmann als junger Mann Geheimliteratur aus der Schweiz nach Russland geschmuggelt hatte, um die Revolution gegen den Zaren zu unterstützen. Er war ein Mitarbeiter Lenins gewesen.
«Lenin lebte während seiner Emigration in Zürich und Genf; Sie können das in den Memoiren von Frau Krupskaja nachlesen; auch die Kurierdienste Ihres jetzigen Brotgebers sind dort erwähnt.»
In der ihr eigenen Erzählfreude schmückte Signora Teresa die Ereignisse, die mehr als dreissig Jahre zurücklagen, in historischer Freiheit aus und beförderte den Kampfgenossen Lenins zum Kurier des Zaren, und mit ironischem Vergnügen zum Zaren selbst. Folgerichtig wurde für sie Frau Paksmann zur Zarin, und wenn ich mit Wischer und Papierkorb bis zur vierten Etage vordrang, begrüsste Signora Teresa mich vergnügt und fragte: «Nun, wie geht es heute dem Herrscherpaar?»
Nicht alle Pensionäre hatten den Humor und die Phantasie, über die Signora Teresa verfügte. Die wenigsten von ihnen wussten die Anstrengungen des Herrscherpaares zu würdigen. Laut sagte ein Pensionär am Frühstückstisch: «Noch immer habe ich in meinem Zimmer kein Bett, das ein Bett zu nennen wäre.»
Allabendlich aber lud die Familie eine kleine Gefolgschaft zu sich in den Salon, in dem Tee getrunken wurde. An der Anzahl der Gläser sah ich, wie gross die Gefolgschaft gewesen war. Es war ein privater Tee, den die Familie servieren liess, und unter den Pensionären wurde eifersüchtig darüber gewacht, wer die Ehre hatte, geladen zu sein. Manchmal holte Herr Paksmann einen für den kommenden Tag bestimmten Dessert aus dem Kühlschrank, um seinen Gästen etwas Besonderes bieten zu können.
«Ich bitte dich, Leone, was wird die Köchin sagen», Frau Paksmann versuchte, Einspruch zu erheben, doch der Gastgeber, dessen Gesicht schon von Freude überzogen war, antwortete, während er den Dessert bereits in kleine Schalen verteilte: «Soll sie sehen, was wird.»
Ich ging nicht gern in den Salon, wenn alle dort versammelt waren. Oft aber gab mir Frau Paksmann gerade dort noch einen Auftrag, der erledigt werden musste, bevor sie am Morgen aufstand. Sie läutete dreimal kurz, wenn sie nach mir suchte.
Ich wusste, dass eine Dame aus Hamburg angekommen war, und ich sah sie zum ersten Mal abends im Salon.
«Lisette, holen Sie aus der Apotheke Sedrol – nehmen Sie Cherili mit», sagte Frau Paksmann. Auf dem Tisch stand der Samowar, und die Dame aus Hamburg sass in einem der tiefen Sessel, die Signora Teresa immer die «Fallen der Comi» nannte. Ich wollte auf sie zugehen, sie begrüssen, als ein Überfall von Zuckungen ihr Gesicht verzerrte. Nase und Kinn stiessen auf die Brust, sodass Haar und Antlitz wie wild geschüttelt wurden. Die entfesselte Unruhe wurde von den Anwesenden übersehen, und mit rascher Hand führte die Unglückliche eine Zigarette an ihrem Oberkörper vorbei, als könne sie mit einem raschen Zug die wilden Bewegungen abfangen. Tatsächlich beruhigte sich das Gesicht.
Cherili zog mich zur Rigi-Apotheke hinunter. Ich fürchtete mich zurückzukehren, fürchtete mich vor einem neuen Anfall, solange ich im Salon war. Welche Anstrengung, das wilde Schütteln zu übersehen, Cherili zog mich im Zickzack hin und her. Die Dackelohren hingen wie Puppenstubenportieren an dem schnuppernden Kopf und halfen mit, die Zeichen der Sympathie ausfindig zu machen, die ein Casanova auf der feuchten Strasse hinterlassen hatte.
Olga hatte erfahren, dass die dunkle Frau aus Hamburg auf schreckliche Weise ihren Mann verloren hat: «Alles Unglück kommt jetzt über die Juden.» Der Mann war seit längerer Zeit verhaftet gewesen, eines Tages aber habe sie die Nachricht erhalten, dass er entlassen werde. Als sie ihren Mann abholen wollte, erhielt sie den Bescheid, dass er tot sei. Gestorben an Herzschlag und bereits begraben.
*
Wer war ihr Mann gewesen – ich hatte nicht den Mut, danach zu fragen. Ich musste an den wütenden Ausspruch meines Vaters denken: «Sie verhöhnen in Rosa Luxemburg die Jüdin und meinen die Revolutionärin …» – «Weil wir Juden sind» hatte auch Ruth Havemann gesagt, und ich konnte beim Abschied nicht die befreiende Wut aufbringen und schämte mich nur. Ahnte ich, dass kein Mitleid umfassend genug war, um einen Menschen trösten zu können, der verfolgt wurde wegen seiner Geburt? Und nicht weil er dachte, was der Verfolger zu denken verboten hatte? Lag das Mitleid deshalb wie eine Lähmung auch zwischen dem Bürger des Gastlandes und dem Flüchtling, dessen Gesichtsausdruck sagte: verfolgt, weil geboren? War Mitleid die Furcht, das Unglück könnte auch über den Mitleidigen kommen, zog das Unglück des anderen das eigene Unglück an? Und erklärte diese Angst erst die Entlastung, die alle empfanden, wenn ein Flüchtling weiterreisen konnte?
*
Mein Zimmernachbar auf der fünften Etage hatte sich als Nissim Nachtgeist vorgestellt. In seinem Zimmer lagen viele kleine, kurze weisse Fäden auf dem Fussboden – und als er mich beim Zusammenfegen antraf, schaute er mich beinah freundlich an: «Nehmen Sie diesen Stall nicht zu ernst – die Comi – ein Ort für die Verlorenen.» Er stellte einen grossen Koffer ab, den er fünf Treppen hinaufgetragen hatte. «Verstehen Sie mich nicht miss, ich gehöre auch dazu.»
Dieses Zusammentreffen war weit freundlicher gewesen als meine erste Begegnung mit ihm, die am Tage nach meiner Ankunft, nachts, auf dem dunklen Korridor der fünften Etage stattgefunden hatte.
Er hatte sich anderntags bei Frau Paksmann darüber beklagt, dass «die deutsche Bohnenstange» ihn nicht gegrüsst habe, und ausdrücklich dazu bemerkt, «dass zum Hochmut kein Anlass vorliegt».
Nissim Nachtgeist öffnete seinen grossen Koffer, der mit verschiedenen zugeschnittenen Stoffteilen vollgepackt war. «Vorderteil, Rücken, Kragen, Taschen, Gürtel mit Einlage, Knopflochleiste, schweizerische Qualitätsarbeit, Gütezeichen, verehrte Nachbarin. Die Schweizer müssen ein Volk in Berufsmänteln sein.» Nissim Nachtgeist sortierte die zugeschnittenen Teile und legte sie zu kleinen Stapeln.
«Ich teile mein Leben zwischen Heimarbeit und Hochschule. Was die Heimarbeit betrifft, Sie sehen es ja, ich lasse Fäden …, mein Hochschulleben? Schwamm drüber.»
Wenn ich abends in seinem Zimmer die Nähmaschine surren hörte, wusste ich, dass Elisabeth, Nissim Nachtgeists Braut, vor der «Bernina» sass und Berufsmäntel nähte. Im Zuge einer rationellen Arbeitsweise trennte sie die zusammengenähten Stücke nicht voneinander, sodass die einzelnen Teile die «Bernina» verliessen wie Wäsche an der Leine. Surrend rannten die Kragen und Ärmel davon, als wollten sie vor den Taschen und Gürteln ans Ziel kommen. Nissim Nachtgeist trennte die einzelnen Teile dann voneinander, durchschnitt den zu einer dünnen Kordel gedrehten Ober- und Unterfaden der «Bernina» und säuberte von zu langen Fäden. Er legte die Teile wieder zu kleinen Stapeln, damit Elisabeth in bequemem Griff «fertig machen» konnte.
Manchmal half ich ihnen.
«Was sagte heute der Herbst?»
Nissim Nachtgeist hörte auf zu schneiden und sah Elisabeth an. Die Schere war für sein handwerkliches Unternehmen viel zu klein, blieb halbgeöffnet und ruhte einem Metallkreuz gleich zwischen seinem Daumen und Zeigefinger: «Die Frage nach dem Wohltäter macht den stärksten Mann hilflos. Aber, geehrte Nachbarin, da Sie Fäden mit uns ziehen, sollen Sie wissen, wer Herbst ist: ein reicher Altwarenhändler, der Kunst und Literatur liebt. Ich habe die Aufgabe, ihm Bücher aus den Bibliotheken zu holen, er verlässt sich auf mein Urteil; das macht mir den Freitisch in seinem Hause erträglich.»
Die von Elisabeth fertig genähten Berufsmäntel wurden von Nissim Nachtgeist noch rasch überbügelt und wanderten dann wieder in den Koffer. Wenn Elisabeth abends in die Comi kam, hatte sie, als Bürgerin des Landes, immer schon einen Arbeitstag als Schneiderin hinter sich, doch setzte Nissim Nachtgeist sie immer unter leichten Druck, was das Arbeitstempo betraf. Wollte er dem Fabrikanten zeigen, dem er pünktliche Arbeit versprochen hat, dass auf einen Flüchtling Verlass war? Gerade weil er Schwarzarbeit leistete?
Читать дальше