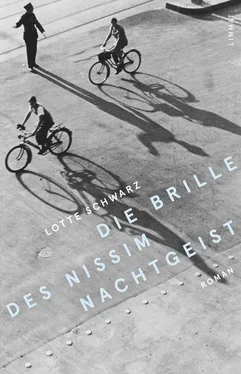Ich hatte das Nachtessen mit den Keksen gespart und zählte mein Geld. Der Mann mit der grünen Schürze hatte inzwischen sicher bemerkt, dass mein Pass am folgenden Tage ablief. Das Federbett schien mir unzweckmässig kurz, es reichte gerade bis zu den Hüften. Ich zog es trotzdem ans Gesicht herauf und dafür die Beine an.
*
Der Mann mit der grünen Schürze deckte bereits den Tisch und fragte mich, ob ich Tee oder Kaffee wünsche. Auf dem Tisch standen Honig und Marmelade. Mit dem Kaffee brachte er eine Zeitung und tippte mit dem Finger auf die Schlagzeile: der Röhm-Putsch. «Was sagt man darüber in Deutschland?» – «Ausser den offiziellen Nachrichten so gut wie nichts.» – «Hier glauben viele Leute, dass der Spuk bald vorbei sein wird.» Sollte das ein Trost sein? Ich ass, aber ebenso gierig las ich die neuen Nachrichten.
Pauls Rat: Trinkgeld immer extra geben. Der freundliche Mann strich es vom Tisch. Mit geübtem Schlag entfernte er mit der Serviette die Brotkrümel vom Tischtuch. Er trug mir den Koffer bis auf die Strasse und zeigte mit erhobenem Arm auf die Haltestelle. «Ottikerstrasse? Fahren Sie von der Haltestelle Limmatplatz in Richtung Bahnhof, dann umsteigen in die Sieben.»
*
Mein Herz klopfte, als ich mit meinem Koffer die steile Steintreppe hinaufstieg. Ein junger Mann mit einem Fahrrad kam mir entgegen, er schob es an der Seite der Treppe, die eine Art Rampe bildete, abwärts. Ich fragte ihn nach der Pension Comi, und mit einer Kopfbewegung seitwärts gab er mir die Richtung an.
Die Pension lag hinter einem Gürtel von Sträuchern. Vor dem Haus sassen einige Leute und spielten Karten. Sie sahen mich kommen, schauten auf, um dann weiterzuspielen. Mir fielen die gepflegten Frisuren der Frauen auf.
Mein Gruss verriet ihnen das Land meiner Herkunft.
Ich musste bis zum eigentlichen Eingang noch einige Stufen hinaufgehen, stellte meinen Koffer auf dem Treppenpodest ab und läutete an der Tür, obwohl sie leicht geöffnet war. Eine kleine Frau erschien – es musste Frau Paksmann sein. «Ah, guten Tag, ich habe Sie erwartet – sind Sie Lisette?»
Ich richtete den Gruss von Paul aus.
«Ein lieber Mensch, er weiss nicht, welchen Gefahren er sich aussetzt. Aber er heisst ja nicht umsonst Paul Kühne.» Ich folgte ihr in ein grosses Zimmer, dessen Tür von einem jungen Mädchen geöffnet wurde. Das Zimmer war mit vielen Möbeln vollgestellt, an den Wänden hingen Fotografien.
«Das ist Helen, meine Tochter» – das junge Mädchen gab mir die Hand.
«Olga soll einen Tee machen», sagte Frau Paksmann zu ihrer Tochter, die daraufhin das Zimmer verliess.
Frau Paksmann setzte sich in die Ecke eines Sofas und lehnte sich zurück; sie war sehr blass. Ich sass ihr gegenüber und schob mit dem Fuss den Koffer hinter meinen Stuhl.
«So jung», sagte sie und schaute mich an, «aber ich weiss, für die Emigration ist keiner zu jung oder zu alt.» Sie fragte nach meinen Eltern und wie viele Geschwister ich habe. «Herrn Kühnes Geschäfte werden schlecht gehen – wer will heute Bücher aus Deutschland kaufen!»
Während sie mit mir sprach, kam sie mir gar nicht mehr so klein vor.
«Meine Pensionäre sind schwierig. Die meisten von ihnen haben alles verloren und mussten aus ihren Heimatländern fliehen. Sie hoffen, nur vorübergehend bei mir zu wohnen; Sie werden es nicht immer leicht haben mit ihnen.»
Es klopfte, ein dunkelhaariges Mädchen brachte Tee für drei Personen.
«Das ist Olga, unsere Meisterköchin.» Frau Paksmann lächelte Olga zu und deutete dann mit ihrer kleinen Hand auf mich. «Lisette, unser neues Zimmermädchen.»
«Wir haben schon am Telefon miteinander Bekanntschaft gemacht», sie stellte das Tablett auf den Tisch und sah mich an. Ich erkannte die singende Stimme wieder.
«Man soll für Lisette das Zimmer in der fünften Etage richten.»
Frau Paksmann sprach meinen Namen anders aus; zu Hause endete Lisette wie Klette oder Wette – es gibt auch Pferde, die Lisette heissen, hatte der Vater einmal zu mir gesagt. Frau Paksmann sprach meinen Namen, als hätte er am Ende kein e, das blieb nahezu unbemerkt, sie zog es weich nach oben. Auf diese Weise ausgesprochen gefiel mir mein Name viel besser.
«Wie kommen Sie zu einem französischen Vornamen?»
«Mein Vater hat französische Vorfahren.»
Wenn dieses Thema zu Hause zur Sprache kam, wies der Vater stets auf die Lübecker Kirchenbücher hin. «Dort steht es klipp und klar», manchmal sagte er auch «schwarz auf weiss», «dass wir einer Hugenottenfamilie entstammen.» Im Anschluss an die Hugenotten erwähnte die Mutter eine geheimnisvolle Verbindung zu einem polnischen Aristokraten, «meine schlanken Hände sind ein Erbteil». Die polnisch aristokratische, wenn auch illegitime Linie bildete, wenigstens geographisch, ein Gegengewicht zu den französischen Vorfahren, ein Gegengewicht, das der Vater zu stören wusste, indem er bemerkte: «Steht aber in keinem Kirchenbuch.» Eine andere Variante unserer Herkunft besagte, dass unser Vorfahre väterlicherseits als französischer Kriegsgefangener bei der Belagerung von Lübeck durch Napoleon von 1805 bis 1807 dort hängen geblieben sein soll.
Walter und Hans umschrieben die Nachrichten über unsere Vorfahren als «Geschichten aus dem Wiener Wald», womit das vom Vater gestörte Gleichgewicht in gewissem Sinne wiederhergestellt wurde, doch das alles zu erzählen, hätte die blasse Frau auf dem Sofa ermüdet.
«Französische Vorfahren? Sie sehen aus wie eine alteingesessene Norddeutsche!»
Wir lachten, der Tee tat gut. Frau Paksmann fragte mich, ob ich Kleider für die Arbeit im Hause mitgebracht habe, was ich bejahen konnte. Meine Mutter hatte mir Kleiderschürzen genäht, «darunter kannst du alles austragen».
Frau Paksmann hatte grosse graue Augen mit Inseln von Bernsteinflecken. «Emigration» hatte sie gesagt – ein neues Wort, das als unbekannte Fracht von den Bernsteininseln zu mir herübergeschickt wurde.
«Warten wir noch», sagte sie, «vielleicht kommt auch mein Mann zu einer Tasse Tee. Mein Mann ist nicht vom Fach, ich selbst bin von Beruf Lehrerin, und es fällt uns nicht leicht, eine Pension zu führen.»
Das Deutsch von Frau Paksmann war für mein Ohr von einer harten Muttersprache durchpflügt.
*
Die Pension Comi verfügte über etwa dreissig Zimmer. Beim Rundgang durch das grosse Haus erklärte mir Helen, dass die Comi eigentlich aus zwei Häusern bestand, die man aber für den Pensionsbetrieb zu einem Haus gemacht hatte, indem man auf jeder Etage die trennende Wand mit einem kleinen, schmalen Gang durchbrach.
«Sie sind ja schlank, wir hatten Pensionäre, die Mühe hatten hindurchzukommen.» Sie lachte und drehte im dunkler werdenden Gang den Kopf zu mir.
Schon am gleichen Tage benutzte ich diesen Gang allein. Ich musste dabei Eimer und Besen vor mir hertragen, so dass am Ende des Ganges zuerst die Putzsachen herauskamen, und dann ich selbst. Und bald hatten auch die Pensionäre zur Kenntnis genommen, dass ich kein neuer Gast, sondern Zimmermädchen war.
Von Olga erfuhr ich, dass die meisten von ihnen jüdische Flüchtlinge waren.
«Sie sind grosszügig zu unsereinem, verwöhnen ihre Frauen und lieben ihre Kinder», sagte Olga. «Ihr seid gemein zu den Juden in Deutschland.» Ich schwieg, und Olga hielt mich womöglich für verstockt, dabei fühlte ich mich wie ein Wasservogel, der Öl an den Flügeln hatte, und doch weiterfliegen wollte. Ich dachte an Ruth Havemann – Gott, waren die Jungs hinter ihr her! Ruth war das schönste Mädchen im Schwimmclub Concordia. Als Ruth mit ihrer Familie Deutschland verliess, sagte sie beim Abschied zu mir: «Es ist, weil wir Juden sind.» Ich schämte mich; hatte ich sie als Jüdin gekannt oder sie mich als Nichtjüdin? Ich hatte sie vor allem wegen ihrer Schönheit beneidet. Ruth war sehr gut auf hundert Meter, sie hatte an den letzten Klubmeisterschaften noch teilgenommen. Durch Ruths Ächtung aber wurde ich geachteter, ich schwamm – nach ihr – Bestzeiten, Bestzeiten der Damen bei der «Concordia», ohne freilich Ruths Zeiten erreicht zu haben. Dabei hatte ich dafür nicht einen Beinschlag mehr gemacht beim Training in den Ohlendorffer Badeanstalten.
Читать дальше