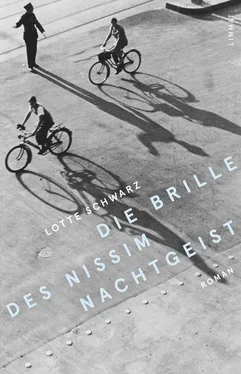Die vierte Etage hatte im Gegensatz zur fünften vollwertige, noch nicht abgeschrägte Zimmer; die Zimmer lagen unter dem Dachfirst. Unter dem Dachfirst aber nisteten die Tauben, und obwohl die Tauben als Symbol des Friedens gelten, lag Signora Teresa mit ihnen in Fehde.
«Die Tauben sind laut und unsozial – sie vermehren sich ständig. Man kann nachts nicht schlafen, und mit der Zeit werden sie die Comi ruinieren.»
Wenn ich auf ihren Balkon ging, um den Flaumer auszuschütteln, musste ich ihr recht geben: Flügelschlagend verliessen die Tauben die Balkonbrüstung, die, grünlich-silbern bekleckst, nicht dazu einlud, die Landschaft zu geniessen.
«Ich gehe nie auf den Balkon», klagte Signora Teresa, und von verschiedenen Pensionären unterstützt hatte sie eine regelrechte Aktion gegen die Tauben gestartet, woraus die Tauben aber als Sieger hervorgingen: «Bei den von Ihnen beschriebenen Tauben kann es sich nicht um Militärtauben handeln, sodass die Stadtverwaltung eingreifen könnte. Militärtauben fliegen niemals auf Bäume und nisten nie unter fremden Dächern – vielmehr bleiben diese über Nacht in ihrem Schlag und haben erst morgens um acht Uhr ihren Freiflug. Da Sie aber auch nachts von den Tauben gestört werden, handelt es sich um sogenannte Türkentauben, welche vor etwa zwanzig Jahren aus dem Balkan einwanderten, und bei uns heimisch wurden. Sie werden vom Bund geschützt und dürfen keinesfalls vernichtet werden.»
Die Tauben waren Emigranten mit Niederlassungsbewilligung.
Von Olga erfuhr ich, dass Signora Teresa eine weitgereiste Dame sei und sechs Sprachen spreche.
«Schau, sie hat halt etwas gelernt.» Olga schlug die Augen nieder, wenn sie etwas gesagt hatte, und das gab ihren Mitteilungen etwas Unwiderrufliches. Signora Teresa hatte herrliche, tizianrote Haare, die wie eine Dauerglut auf ihrem Kopf leuchteten, und wenn sie mit ihrer leicht angerauhten Stimme sprach, glaubte man ein Knistern zu hören, das die Glut in Flammen aufgehen lassen könnte.
«Ich kenne Ihr Land», sagte sie zu mir, «vor vielen Jahren war ich in Berlin. Mussolini war an die Macht gekommen, und ich hatte auf einem Meeting die Rede eines jungen italienischen Antifaschisten zu übersetzen. Ein trauriges Land», sagte sie und hielt wie abwehrend ihre rosafarbenen Handflächen gegen mich, «die Polizei führte die Strassendemonstration an, und Genossen, versehen mit einer Armbinde, worauf ‹Ordner› stand, sorgten dafür, dass kein öffentlicher Rasen beschädigt wurde. Nie wird es in Ihrem Land eine echte Revolution geben!» Sie schüttelte dabei die rote Glut auf ihrem Kopf und lachte.
«Ich kenne Berlin nicht», antwortete ich und dachte an mein Berlin, an einen fernen, blauen Dunst am Horizont …
Als Freundin der Familie aber war Signora Teresa um Ordnung im Hause besorgt. «Sagen Sie dem Studenten von Nummer 29, dass die vierte Etage empört ist!»
Der Student hatte das Badezimmer in einem ungehörigen Zustand hinterlassen, und entrüstet fragte mich Signora Teresa, zu welchem Zwecke dieser Kretin Architektur studiere – sein Benehmen sei ein Hohn auf seinen herrlichen zukünftigen Beruf.
In Nummer 29 herrschte eine Anarchie von Kleidern, Büchern und Toilettenartikeln, der Student selber war ein Monument an Pflege. Der junge Mann schien ausgehen zu wollen, doch nicht ohne Freundlichkeit hörte er den Vorwürfen zu, die ich im Auftrage von Signora Teresa zu übermitteln hatte.
«Sauberkeit macht noch kein Kulturvolk, und zudem – liebes Kind – dürfte es in Ihrer Sprache auf der ganzen Welt schwierig sein, Beschwerden anzubringen …» Duft hinter sich lassend verliess er sein Zimmer und strebte dem Treppenhaus zu. Ich hatte Lust, dem Lackaffen mit meinem Flaumer die tadellose Frisur zu verderben, «Poussierstengel» riefen wir als Kinder jungen Männern nach, die nach Parfüm rochen.
Frau Paksmann schaute mich müde an, als ich ihr von den Frechheiten des Studenten erzählte. «Ich weiss nicht, ob es je Ordnung geben wird – unbefohlen – immer stimmt etwas im Hause nicht, es gibt keine Ruhe für mich.»
Ruhe für die Familie, wenn auch nur für kurze Augenblicke, konnte allein Cherili vermitteln. Cherili, besser Chärrilie, ein langhaariger grauer Dackel. Cherili musste nur auftauchen, und schon trat Glanz in die Augen der geplagten Pensionsbesitzer. Cherili verteidigte die Familie gegen die dauernden Begegnungen mit den Pensionären und deren Angelegenheiten durch ihre einfache Existenz. In einer Mischung von Souveränität und Melancholie liess sich Cherili die Liebe der Familie gefallen. Herr Paksmann sprach manchmal russisch mit dem geliebten Tier. Zu seiner Zerstreuung ging er manchmal mit Cherili auf den Uetliberg; man nannte ihn in der Nachbarschaft den grauen Herrn mit dem weissen Haar. Er war von hoher Gestalt und trug mit Vorliebe graue Sportanzüge mit Knickerbocker, doch wirkten die englischen Sporthosen an ihm wie schlechter Wille. Es konnte aber auch sein, dass die Hosen ihn nicht mochten. Sein aufrechter Gang jedoch, die jugendliche Gesichtsfarbe und das volle Haar triumphierten schliesslich über die Verdriesslichkeiten machtpolitischer Natur, handelte es sich bei seiner äusseren Erscheinung doch um eine russisch-englische Allianz.
Frau Paksmann benutzte die Abwesenheit ihres Mannes manchmal dazu, einen säumigen Zahler zu mahnen. «Sie sind doch ein gebildeter Mensch und wissen, dass ich keine Geschäftsfrau bin», so entschuldigte sie sich, klagend, bei dem Säumigen. Herr Paksmann duldete es nicht, dass ein Pensionär gemahnt wurde, er ignorierte die finanzielle Seite seines Unternehmens. Gewiegt zog er die Augenbrauen hoch und sagte: «Der Arme – er wird kein Geld haben.» Er sass oft in seinem Büro, ein pompöser Name für den gefangenen, handtuchgrossen Raum ohne Fenster, der früher einmal ein Aufbewahrungsort für Putzutensilien gewesen sein mochte. Er sass dort vor aufgespiessten Lieferscheinen, und niemand konnte die Gefühle erraten, die er dem Pensionsunternehmen gegenüber empfand. Einmal suchte ihn Signora Teresa in seinem Büro auf, um ihren monatlichen Pensionspreis zu zahlen. Sie hielt ihm das Geld entgegen, er aber deutete gereizt auf die Brusttasche seines Sportanzuges und sagte ungeduldig: «Stecken Sie es hinein, Teresa», und sah nicht einmal hin, wie viel Geld sie in den wollenen Schlitz versenkte. Dabei schien er das Büro sehr wichtig zu nehmen, nur er besass einen Schlüssel dazu, den er ernst in den tiefen Taschen der Knickerbockerhose aufbewahrte.
Allen bekannt aber waren die Gefühle, die Herr Paksmann Cherili gegenüber empfand; ihm war der Gedanke peinlich, dass sich die Reinrassige mit einem Partner ohne Stammbaum und Ansehen den Hundehimmel teilen könnte, und er führte Cherili beim Spaziergang immer an einer kurzen Leine.
Ihr Lieblingsplatz im Hause war die Heizung im Office neben dem «Pass». Schwer geprüft lag Cherili auf den warmen Röhren und schnupperte dem Geruch der Speisen nach, der durch den Pass von der Küche herauf an der Hundenase vorbeizog. Der Pass, eine Schlucht von braunen Brettern, verband das Office mit der Küche, die im Erdgeschoss des Hauses lag. Hier am Pass brandete das Leben der Comi wohl am heftigsten, hier am Pass verlor sogar Olgas Stimme ihren Charme, ihre Mitteilungen von unten herauf hatten nur noch etwas von einem eigenartigen Röhren. Ich weiss, dass sie unten ihren Kopf schräg in die Schlucht hält, damit Herr Paksmann sie oben besser verstehen kann. Er gab seine Befehle zurück, aber man wusste nie, ärgerte er sich über Olga oder beleidigte ihn diese Beschäftigung.
Herr Paksmann war sehr unzufrieden mit mir, wenn ich Cherili von der Heizung hinunterjagte.
«Ein wertvolles Tier», sagte er, aber ich hatte die Teller dort vorzuwärmen. Vor dem Mittagessen waren wir alle in Zeitnot. Herr Paksmann wartete am Pass auf die Speisen, die Olga hinaufschickte; seine Knickerbockerhosen waren um diese Zeit mit einer weissen Schürze gedeckt. Cherili aber fortzujagen, war aussichtslos. Nachdem sie von der Heizung hinuntergesprungen und beleidigt ins Treppenhaus gewackelt war, kam sie mit dem nächsten Pensionär, der dem Speisesaal zustrebte, wieder zurück in das Office. Sie nahm Herrn Paksmanns nervösen Schrei: «Geh weg – was ist los?» als Aufforderung zu bleiben.
Читать дальше