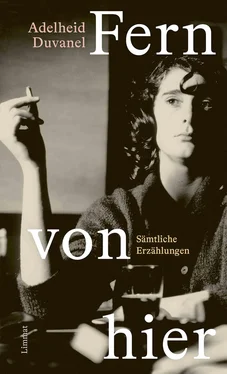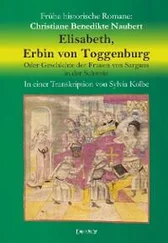Seit dem Unfall war Fränzi nicht mehr am Strand gewesen, und ihre Mutter hatte das Haus seit der Beerdigung nicht mehr verlassen; jeden Tag ging das Mädchen eine Viertelstunde weit ins Dorf, um einzukaufen. Nackt und frierend schienen die weißen Häuser im Wind zu stehen, der Sand gegen die Scheiben warf und die verblichenen, klappernden Storen hinauf- und hinunterzerrte. Ein lahmes Kind bewegte sich manchmal auf Händen und Füßen über die holprige Straße und trug eine Tasche im Mund; wenn der Wind es umwarf, rappelte es sich wieder hoch, drehte sich auf sonderbare Weise einmal um sich selbst, schlenkerte die dünnen, krummen Beine und hoppelte weiter. Es hatte ein hübsches Gesicht und braune, kräftige Hände. Wenn Fränzi an der Kirche vorbeiging, erinnerte sie sich, wie Martin auf das Kreuz gezeigt und gefragt hatte: «Weshalb ist da ein Flugzeug auf dem Dach?» Er war noch so klein und unwissend, aber Fränzi wurde von ihrer Mutter jeden Tag vier Stunden lang in Aufsatz, Mathematik und Fremdsprachen unterrichtet. (Sie wusste, dass manche Leute an einen lieben Gott glaubten, der sich aus dem Himmel beugte und eifersüchtig und nörgelnd ihr Tun beobachtete; alles, was mit diesem lieben Gott zusammenhing, ging sie, die Mutter und Martin nichts an.) Seit Martins Tod fiel ihr das Lernen schwer; es war, als habe jemand einen Sack voll kleiner, scharfer Messer über sie ausgeleert, die alles auftrennten, was die Mutter ihr in den Schulstunden beigebracht hatte: Die Wörter zerfielen in Silben, die Silben in Buchstaben, die Buchstaben in Striche und Halbkreise.
Manchmal sah sie im Traum Martin wie das lahme Kind auf Händen und Füßen auf einem steinigen Weg; ihr Herzschlag setzte aus, doch plötzlich richtete er sich auf und kam zu ihr gerannt; sie sah sein liebes, lachendes Gesicht ganz nah, blickte in seine Augen wie in weit geöffnete Blumenkelche und drückte seinen kleinen Körper an sich, doch dann schien jemand ihr Herz mit zwei Nadeln auseinanderzuziehen; der Schmerz ließ sie erwachen und sie wusste, dass Martin tot war und weinte lautlos, fast ohne die geöffneten Lippen zu verzerren.
Im Himmel leuchtete die Sonne wie ein runder Gott, den der Priester über dem Altar zeigte. Winde rasten vorbei und läuteten im Wasser, das die Mutter in einem irdenen Krug von der Zisterne zur Küche trug. Im tiefen Brunnen schwamm seit vielen Tagen eine tote Eidechse; die kleine Leiche ruderte mit dem Schwanz und den Füßen, sooft der Eimer ins Wasser tauchte; das wirkte ungehörig. Stieß man mit dem Eimer nach ihr, schwamm sie davon.
Fränzi hasste die tote Eidechse, die so tat, als lebte sie noch, und die sie nur einmal gesehen hatte, da die Mutter ihr nicht erlaubte, Wasser zu holen; das Heraufziehen des Eimers und Tragen des Kruges hätte die Kräfte des schmächtigen Kindes überfordert. Selbst das Heben des hölzernen Deckels gelang Fränzi kaum; der Wind versuchte ihn ihr aus der Hand zu reißen. Die Mutter war zum ersten Mal seit der Beerdigung des Brüderchens ins Dorf gegangen, um einen Brief an ihre Schwester einzuwerfen; sie gedachte, mit Fränzi in einer Woche nach Hause zu fahren – dann war es ein Jahr her seit Martins Tod. Vorher aber wollte Fränzi versuchen, mit dem Eimer die Eidechse hochzuheben; die Mutter hatte es schon einige Male probiert, doch immer war das tote Tier ihr entwischt.
Nachdem Fränzi den Deckel weggehoben hatte, ließ sie langsam den Eimer hinunter; der Wind strich über das schwarze Wasser und zerteilte ein blaues Fenster, aus dem sich ein Mädchen beugte, dem fuchsrote Zöpfe über die Schulter hingen; Fränzi hatte erstaunt sich selber erkannt und sich an ihrem Spiegelbild gefreut; es war, als ob Goldmarie ihr zugenickt hätte. Andere Märchen fielen ihr ein, in welchen tiefe Brunnen eine Rolle spielten: Rotkäppchen oder die sieben Geißlein. – Die Eidechse bewegte sich. Vorsichtig versuchte Fränzi, ihr mit dem Eimer zu folgen, doch sie wich gegen den Rand hin aus; eine Weile war sie im Dunkel verschwunden, dann trieb sie wieder gegen die Mitte. Fränzi schwenkte mit dem Eimer, der sich rasch füllte, gegen die Mitte und kletterte auf den Brunnenrand, das Seil mit der Faust krampfhaft haltend – weit beugte sie sich hinunter. Ein gellender Schrei ließ sie zusammenzucken; sie sah ihre Mutter mit schreckgeweiteten Augen auf sich zueilen und glitt langsam auf den Boden, wobei sie nicht merkte, dass ihr das Seil aus den Händen fiel und in den Brunnen klatschte. Zitternd ließ sie sich – zum ersten Mal seit des Brüderchens Tod – umarmen und schluchzte: «Die eklige Eidechse – Mama, nimm die Eidechse weg; mir graut vor ihr.»
In wenigen Tagen würde Sabel – eigentlich hieß sie Isabelle wie die Mutter – mit den Eltern und vier jüngeren Geschwistern in eine Notwohnung eingewiesen werden; in eine der Baracken am Fluss, wo auch das dunkelhäutige Mädchen lebte, dessen Namen sie nicht kannte. Das Haus, in dem sie wohnten, wurde abgerissen.
Sabel hatte stets entzündete, geschwollene Augenlider; man hatte den Eindruck, sie könne die hellen Augen auch von unten her schließen. Sie stellte sich vor, dass sie kein Kind wäre, sondern eine in ein Kind verwandelte Erwachsene. Während Kinder wie die Dunkelhäutige sich schützen konnten, weil sie niedlich und drollig wirkten und bei Erwachsenen Zärtlichkeit hervorriefen, war Sabel – so fand sie – ein kleines Scheusal, nicht weniger hässlich als die Großmutter der Mulattin, deren roter Rücken im Sommer faltig über das hinten weit ausgeschnittene Badkleid hinunterhing. Der Gedanke, die drei großen Zimmer mit der vergilbten Tapete, den hohen Fenstern und den knarrenden Türen für immer verlassen zu müssen, in welchen sie nun ein Jahr lang gelebt hatten, verursachte Sabel Schwindel und Angst, auch war es keine Beruhigung, die Schwarze nun ganz in der Nähe zu haben; sie hatte noch nie mit ihr gesprochen und fürchtete sich, sie wirklich kennenzulernen, denn sie hatte ein blitzendes, unbarmherziges Lachen. Gerne wäre Sabel stumm zur Welt gekommen; am liebsten saß sie auf einem Stuhl und dachte sich Handlungen aus, in deren Verlauf das dunkle Mädchen von ihr vor dem Tode errettet und dann auf unklare Weise angebetet wurde, indem sie ihm überallhin folgte, alles tat, was es befahl, sogar stahl und schließlich seinetwegen starb.
Sabel lebte wie in einem Zelt, das immerzu mit neuen Bildern, Szenen und Zeichen bemalt wurde; das Tuch aber wurde kleiner und kleiner geschnitten vom Ticken der Uhr, die im Esszimmer auf der Kommode stand. Bald würde sie das Zelt nicht mehr brauchen, das ihr Horizont war, das ihr die Sicht in die Ebenen, in die Weite jenseits verwehrte, um sie zu schützen. Vorläufig hatte sie noch Bilder und Zeichen nötig, brauchte sie das Mulattenmädchen mit den großen Lippen und den Augen, die so schwarz waren, dass sie ohne Blick zu sein schienen; Sabel stellte sich manchmal vor, das Kind sei blind und sie führe es, läse ihm vor und lasse sich anschreien, weil sie nur mühsam buchstabieren konnte.
Sabel war eine schlechte Schülerin, aber sie war der Meinung, nur sie allein wisse, dass der Schnee am frühen Morgen blau war, dass im Frühling die Äste der Bäume wie mit einer Zuckerlasur bestrichen waren und die Sommerabende als milder, süß duftender Rauch überallhin quollen. Sie liebte den Baum hinter dem Haus; im Herbst stand er auf einem Bein im Regen; seine vielen bunten Flügelchen hatte der Wind davongeblasen und der Baum hatte doch so sehr gehofft, einmal wegfliegen zu können.
Sabel durchquerte den Vorgarten; sie schleppte den Schulsack wie einen Koffer, während andere Kinder ihn am Rücken trugen. Einige Schwalben schnellten schreiend die Straße entlang; ihre Schatten glitten über die Hauswände. Der Vater hatte sie letztes Jahr fotografiert, als sie sich auf dem Draht versammelt hatten; Sabel liebte die Fotos und hatte sie über ihrem Bett aufgehängt, doch die Mutter hatte sie wieder heruntergerissen, zerknüllt und in den Ofen geworfen.
Читать дальше