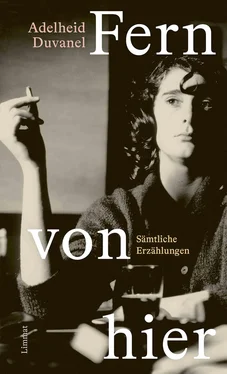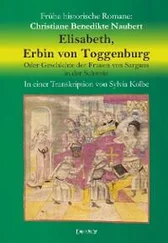An einem Sonntagabend, als die Lichter des Hochkamins der städtischen Kehrichtverbrennungsanstalt merkwürdig hastig zum Wohnzimmerfenster hereinblinkten und ein Re genbogen wie ein schlanker, schillernder Blütenstengel unter dem schwarzen Himmel wuchs, hüpfte Otto plötzlich auf der Scheibe des Fernsehers als Eiskunstläufer. Herr Weinwild erkannte ihn sofort an den Augen, die den Blick eines verwundeten Äffchens hatten. Nach einigem Zögern wagte sich Herr Weinwild ebenfalls aufs Eis, sprang an Ottos Seite und drehte sich im Takt einer fremd klingenden Musik, doch der Applaus des Publikums blieb aus. Ob die Zuschauer ahnten, dass das Paar nur die misslungene Kopie eines früheren Paares war, das sich Herr Weinwild eine Zeitlang ausgedacht hatte?
Bruder August machte früh den Eindruck, als hätten wir ihn uns nur geliehen. Nichts, was er tat, schien er aus einer Gewohnheit heraus zu tun. Er hatte in nichts Übung: weder im Klettern oder Rechnen noch im Lachen. Das Gefühl, nur irrtümlicherweise unter uns zu weilen, schien ihn ganz zu beherrschen; er bemühte sich nicht, angenehm zu wirken, und so waren wir der Überzeugung, er mache sich nichts aus uns und unserer Welt.
In geschlossenen Räumen erwartete August Befehle, Drohungen und Tadel; die Angst trieb ihn hinaus. Er umhüpfte unser Haus in immer größerem Bogen, flatterte durch Außenquartiere, huschte mit Raben und Möwen über Felder, bestieg eines Morgens ein Flugzeug und flog in den unbegreiflichen Himmel hinein – niemand wusste, wohin. Ich vermute, dass er ein Flugzeug nahm, um den Wind nicht zu spüren, der in jenen Tagen an allem rüttelte. Als das Telefon schrillte, hielt ich den Hörer nicht nah ans Ohr, begriff aber, dass eine Stimme mich knapp über Augusts Flucht unterrichtete. Ich teilte den Eltern das Vorgefallene mit und bemerkte, dass Mutter die Uhr vom Handgelenk nahm und die Brille von der Nase hob, als kümmerten sie Zeiten und Bilder nicht mehr. Die Dunkelheit verdichtete sich; vielleicht umlagerten doch ziemlich hohe Schneewälle die Stadt, und ich sah durchs Fenster Blätter gekrümmt über den Asphalt kriechen. Vater erklärte beschämt: «Er war schon immer anders.» Befremdet blickte ich auf die Löwenfüße eines Sessels, der sprungbereit in der Zimmerecke stand. Ich dachte an Mutter, wie sie von ihrer Mutter erzählt hatte: «Sie hat bei einem Antiquar einen Großvaterstuhl gesehen und nicht gekauft, weil Großvater tot war, und dann doch gekauft und ihren Mann hineingesetzt.»
Ich erinnere mich, dass August als Junge hie und da zu mir kam und versuchte, etwas mitzuteilen. Einmal sagte er: «Ich spüre es genau: Diesmal ist die Nacht innen.» Ein andermal stand er neben mir im Vestibül unserer Wohnung und betrachtete ein Theaterplakat, das ich über die vier Glasscheiben der Tür geklebt hatte, die ins Treppenhaus führte; zaghaft strich er mit dem Zeigefinger über die weiße Tänzerin. Unerwartet wurde der Hintergrund weggerissen; jemand hatte im Treppenhaus das Licht angeknipst. Entsetzt wies August auf den schwarzen Rahmen in Kreuzesform, der nun hinter dem leuchtenden Bild sichtbar wurde.
Seitdem ich erwachsen bin, erzähle ich den Leuten, August wohne in einem Schloss mitten im Wald – «Mischwald», füge ich, das Genaue liebend, hinzu. Ein Diener staube die weißen Heizkörper in den hohen Räumen ab und August esse vornehm hinter gerafften Vorhängen. Der Diener streue eine Prise Salz aus einem Gefäß, das in Zierschrift mit «Sucre» beschrieben sei, in die Waldbeerensuppe seines Herrn. August sei umgeben von Kakteen und lustwandle oft in einem gedeckten Innenhof; durch eine Luke im Glasdach wachse ein Baum, der sowohl mit den Wurzeln als auch mit der Krone denken könne.
Je ausführlicher ich berichte, desto steiler wächst mein Stolz auf den Bruder. Ich habe mir August geliehen, um ihm Gewohnheiten anzudichten und um ihn mir angenehm zu machen. Aber wenn ich am Abend von der Arbeit komme, wende ich mich ständig um. Kürzlich sah ich, um nur ein Beispiel zu nennen, einen Herrn, der in einiger Entfernung stand und mir den Kopf zuwandte, wobei er den Mund öffnete und schloss. Heute entdeckte ich einen Mann, der die Straße herunterrannte und schrill durch die Finger pfiff. Ich wollte rufen: «Ich habe nichts getan!», doch dann beschleunigte ich meine Schritte, trat hastig ins Haus und warf die Tür ins Schloss.
Wenn Fränzi sich nach trockenem Holz und Pinienzapfen bückte, ließ sie sich vom Wind überrollen. Sie suchte das Meer, das an stillen Tagen wie eine Mauer in der Ferne stand und einen Berg trug; jetzt verbarg es sich hinter einem kleinen Nebel. Zerzauste Schafe zitterten, wenn die wie Nonnen gekleideten Bäuerinnen breitbeinig und böse krächzend über die steinigen Felder liefen, und die Mutter sagte: «Der Wind quält.»
Auch in den Nächten knatterte der Wind pausenlos über unsichtbare Straßen; die Vorhänge vor den geschlossenen Fenstern bewegten sich und das hastige Klopfen des Weckers neben der Kerze schien Fränzis Herz nachzuäffen. Die Mutter schlief nicht; Fränzi sah ihre komische, kurze und spitze Nase, die die schmalen Lippen überdachte, doppelt: an der Wand als graue Tuschmalerei und über der Bettdecke pfirsichfarben. Viele Kerzen und viel Petrol brauchte man in solchen Nächten, in denen neben dem Hut am Haken mit dem darübergeworfenen Kopftuch ein stumpf erstauntes, zungenzeigendes Froschgesicht an der Wand erschien, das davonschwamm, wenn der Morgen kam.
Manchmal flüsterte Fränzi: «Mama, wann fahren wir nach Hause?», dann hob die Mutter den Kopf von ihrem Buch und sagte: «Schlaf.»
Aber es war schwierig, den Schalter für den Schlaf zu finden, wenn man draußen das rhythmische Rauschen und Summen hörte – als ob der Wind mit einem riesigen Wasserfall spielen würde. Manchmal krachte die Tür, und Fränzi stellte sich schaudernd vor, wie der Wind im Kamin in der Küche miaute. Wenn der Schlaf die Hand auf ihr vor Angst kaltes Gesicht legte, sah sie zwischen seinen Fingern auf dem Nachttisch Disteln in einer Flasche, die vor einem grauen Distelbaum standen, der die Wand hinaufgewachsen war und sich an der Decke über Fränzi und die Mutter beugte; vielleicht war es auch ein Sternbaum – die Nacht war voll glitzernder Sternbäume, an deren Äste der Wind turnte als Affe ohne Pelz; er besaß eine narbige Lederhaut und schwamm von Baum zu Baum. Er hatte das Brüderchen geholt, das im Meer ertrunken war, und trug die Leiche als Gürtel um seinen Bauch. Vom Brüderchen standen Fotografien im Esszimmer; es hatte einen großen Kopf mit braunem Haar und lachte gern. Sein Lachen schien immer noch in den Wänden des Hauses, das vor dem Tod des kleinen Martin nur ein Ferienhaus gewesen war, verborgen zu sein; wenn Fränzi lauschte, hörte sie es leise klingen – wie aus weiter Ferne; ob die Wände in die Ferne gerückt waren?
Wie die Orgel in eine Kirche, so gehörte Martins Lachen zu diesem Haus. Jahrelang hatte die Mutter mit ihren beiden Kindern den Sommer hier verbracht. Nun war aber der Sommer längst vorbei; der Herbst und der Winter versuchten, vor Martins Tod zu stehen und ihn zu verstecken, doch es gelang ihnen nicht; zuerst kam der März und wusch mit seinem Regen ein Stück von ihnen weg, und nun war der April da mit seinem Wind, der sie umstieß. Die Erinnerung an Martins Tod war so deutlich und schmerzlich grell wie im Sommer; es gab keine Sekunde, in der Fränzi nicht wusste, dass er gestorben war.
Sie waren letztes Jahr früher als sonst hier angekommen; der lange Regen war vorbei, aber das Haus innen noch feucht. Die Mutter öffnete Türen und Fenster, stellte die Matratzen hinaus und ließ die Leintücher an der Leine flattern. Fränzi wusste es noch genau; sie und Martin sammelten Schnecken und betrachteten einen Wiedehopf, der mit seinem Weibchen spielte. Der Morgen und der Abend waren am andern Tag kalt, doch am Nachmittag brannte die Sonne und der Wind war sanft und lustig. Die Mutter erlaubte ihnen, im Meer zu schwimmen, während sie das Haus putzte, und auch am nächsten Tag wanderten sie eine halbe Stunde bis zum Strand und vergnügten sich im noch kühlen Wasser, während die Mutter Briefe schrieb. Da geschah der Unfall; Martin lieh sich von einem andern Jungen die Taucherbrille aus und ertrank, ohne dass jemand es sofort bemerkte. Fränzi erstellte mit kleinen Ästen eine Hecke um ihre Sandburg; niemand war am Strand als die Mutter des andern Jungen; sie schlief rot und dick und ölig – später weinte sie. Ihr Sohn, ein leicht idiotisches Kind von zehn Jahren, das die zwölfjährige Fränzi um Haupteslänge überragte, fand den toten Martin und verkündete das Ereignis später immer wieder stolz.
Читать дальше