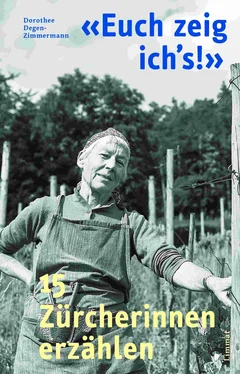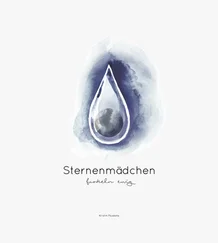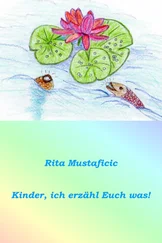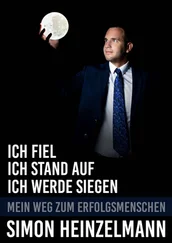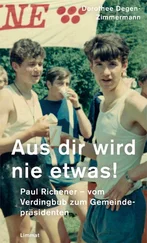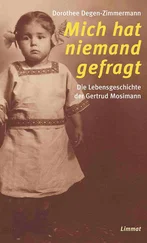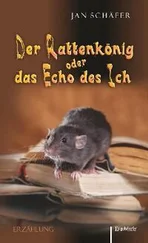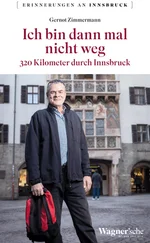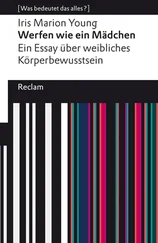Jenseits der Grenze ist Krieg
Ruth geht in die dritte Klasse, als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Die Generalmobilmachung holt die Männer von den Erntefeldern. Und – ebenso einschneidend für die Bauernbetriebe – auch die Pferde werden eingezogen. Harte Arbeit für alle Daheimgebliebenen, auch für die Kinder. «Man musste sich zu Tode schaffen damals, es war kein brauchbares Hosenbein mehr hier. Man hatte allenthalben zu wenig Hände.»
Im Frühling 1940 zieht sich die Schlinge rund um die Schweiz zu. In Wil erwartet man täglich den Befehl zur Evakuierung. Die Bäuerinnen werden aufgeboten, den Auszug zu proben: Wie lange dauert es, bis sie das Vieh über die Eglisauerbrücke getrieben haben? Keinesfalls will man den Deutschen den Rindsbraten überlassen! Mitten im verhassten Kartoffelstecken ist die Aussicht, fortzugehen, verlockend. Endlich keine dreckigen Hände mehr! Ruth stellt sich die Evakuierung abenteuerlich vor. Sie ist ja noch kaum je über das Rafzerfeld hinausgekommen. Wohin würden sie fliehen? Wo würden sie untergebracht?
Die Grenze vom Rhein um das ganze Rafzerfeld herum bis wieder zum Rhein wird mit vierfachem Stacheldraht gesichert. Gegen Menschen, nicht gegen Panzer. In den ersten zwei Kriegsjahren ist die Angst besonders gross. Die Männer sind weit weg, im Reduit.
Einmal kommt es zu einer Begegnung am Grenzzaun. An einem Sonntagnachmittag in der Weihnachtszeit gehen ihrer paar Mädchen, sie nennen sich die «Sonntagsbande», ins Holz hinauf go striele. «He, Kinder!», werden sie von jenseits des Stacheldrahtzauns angesprochen. Der Mann trägt eine schäbige Uniform, sein Deutsch klingt ganz anders als das vertraute Schwäbisch der benachbarten Dettighofer, fast unverständlich. «Ihr seht gut genährt aus», stellt er fest und erzählt von den polnischen Kriegsgefangenen, die er bewache, vom Hunger und dass er «heim zu Muttern» und «Plätzchen essen» möchte. Und die Mädchen wundern sich, wie viele Mütter er hat und dass man Plätzchen essen kann. Am nächsten Sonntag bringen sie, was sie zu Hause stibitzt haben, Chrööli, Käse, und die kecke Els bringt gar ein Stück Geräuchertes mit, weil sie das selber nicht mag. Sie schieben die Sachen in eine trockene Entwässerungsröhre, die unter dem Grenzzaun hindurch auf die deutsche Seite ragt. Dreimal werden die Sachen abgeholt, das vierte Mal macht sich der Fuchs darüber her.
Gefragt nach Flüchtlingen, fallen Ruth Angst merkwürdigerweise zuerst diejenigen ein, die die Grenze Richtung Norden passiert haben. Der Apotheker von Rafz etwa und Lehrer W., von dem die Leute sagen, er sei ein choge Nazi, verschwinden, nachdem im Herbst 1942 die ersten Todesurteile wegen Landesverrat bekannt werden. «Wir sind so gern zu dem in die Schule gegangen. Er war bildhübsch. Ich habe noch lange für ihn gebetet.»
An einem Wintermorgen wird sie früher als sonst geweckt: «Zieh dich weidli an, in der Küche steht einer.» Die Mutter hat in den frühen Morgenstunden in der Küche das Kraftfutter gerichtet für eine Kuh, die in der Nacht gekalbt hat. Da wird ans Fenster geklopft. Ein Fremder, das einzige Wort, das sie versteht, ist «Bahnhof». Ruth ist fasziniert: «Ein Bild von einem Mann! Schwarze Haare, schwarze Augen, ein Zigeuner vielleicht, ganz anders als die Alemannentypen in unserem Dorf.» Auf Geheiss der Mutter begleitet sie ihn die drei Kilometer zum Bahnhof Hüntwangen-Wil, ohne ein Wort wechseln zu können.
Der hat es geschafft über die Grenze, andere nicht. Vom Polenlager erfährt Ruth Angst später Schauriges. Ihre Familie besitzt Land ennet der Grenze im nahen Dettighofen. In den ersten Kriegsjahren ist die Grenze hermetisch geschlossen. Aber später dürfen die Bauern wieder hinüberfahren, um ihr Land zu bewirtschaften. Da zeigen deutsche Nachbarn hinüber zur grossen Linde am Waldrand: Dort hängen vier Polen. Sie wollten in die Schweiz fliehen und wurden erwischt.
Der Krieg ist nahe, sehr nahe. An einem Nachmittag im Herbst ist die Familie am Kartoffellesen im Hard, dem Gebiet südlich der Bahnlinie, aber nördlich des Rheins. Manchmal schaut Ruth Angst den Güterzügen nach, die von Italien nach Deutschland rollen oder umgekehrt. Da wird sie von einem amerikanischen Fliegergeschwader aufgeschreckt – «den Ton werde ich nie vergessen!» –, das herabsticht und einen langsam nordwärts tuckernden Güterzug beschiesst, immer und immer wieder. Der Schrecken ist gross. Als es wieder ruhig ist, siegt die Neugier. Aber die Heerespolizei ist schon zur Stelle und weist die Schaulustigen weg. Später spricht sich herum, in den Fässliwagen befinde sich italienischer Rotwein. Wer ein Velo hat, fährt zum Schauplatz. Die Tankwagen weisen Schusslöcher auf, aus denen der rote Saft rinnt. Den lassen sich die Männer nicht entgehen, stellen die mitgebrachten Eimer unter. Der italienische Wein ist süsser als das damals noch ungepflegte Eigengewächs. Als der Vater spät an jenem Abend nach dem Vieh schauen will, fällt er die Treppe hinunter. Sein Jammern lässt die Mutter ungerührt. «Geschieht ihm recht», brummt sie.
Der Anbauplan Wahlen bringt viele Vorschriften für die Bauern, sie müssen Raps anbauen, weil das Speiseöl fehlt, und Wald roden, um Ackerland zu gewinnen. Familie Angst wird letzteres zum Verhängnis. Im Februar 1944 fährt der Vater mit Ross und Wagen ins Holz, um Bäume zu fällen. Er wird von einem Baum getroffen und stirbt noch auf der Unfallstelle. Der Verlust legt sich wie ein dumpfer Schatten auf die Familie. Es wird still, alle gehen stumm ihren Pflichten nach. «Man hat sich geschämt, Trauer zu zeigen, man musste doch tapfer sein.» Die Mutter arbeitet noch mehr als bisher, und Grossvater, «der General der Dynastie» nimmt noch einmal das Heft in die Hand. Aber die jungen Knechte nehmen ihn nicht ernst. Einmal kommt er verärgert und verdreckt in die Küche, um sich zu waschen. Der Jakob habe ihn auf den Mist gestossen.
Gegen Ende des Krieges, am 22. Februar 1945, wird das Nachbardorf Rafz von einem alliierten Flugzeug bombardiert, das hört man bis nach Wil. Ein Haus wird dabei voll getroffen und eine ganze Familie, drei Erwachsene und fünf Kinder, kommt ums Leben.
Am 8. Mai 1945 in aller Frühe trifft sich Ruth Angst mit ihren Schulkameraden der 3. Sekundarschulklasse im Wald oben, um Maikäfer einzusammeln. Sie breiten Tücher unter den jungen Buchen aus. Wenn die Käfer von der Morgenkälte noch starr sind, kann man sie von den Bäumen schütteln wie Obst. Zwei Bücki zu je 75 Liter füllen sie, binden einen Sack darüber, damit die Käfer nicht entweichen, schütten sie beim Bad-Wirt ins Güllenloch und erhalten dafür von der Gemeinde 11 Franken für die Klassenkasse. Als sie zum Schulhaus kommen, ist der Platz mit Hortensien geschmückt. Die in Wil einquartierten Innerschweizer Soldaten stehen herum und scheinen auf etwas zu warten. Mit müden Köpfen und Beinen stehen die Kinder an Fritschi-Schreiners Hag und warten auch. Als eine Fanfare erschallt, werden die Soldaten auf dem Platz ganz still. Und nun geschieht Befremdliches. Männer in gestickten Röcken kommen aus dem Schulhaus, kleine rauchende Pfännchen schwingend, fromme Gesänge werden angestimmt, die Männer bekreuzigen sich, knien nieder. Die Kinder in ihrer Müdigkeit fangen an zu kichern. «Bei uns war eben niemand katholisch, wir hatten noch nie eine Messe erlebt.» Danach gehen sie ins Schulzimmer hinauf, um beim Lehrer das Maikäfergeld abzugeben. Da beginnen die Kirchenglocken zu läuten. «Es ist Friede jetzt, ihr habt heute frei», sagt der Lehrer. «Als ich heimkomme, sitzt der Grossvater am Radio. Er hat Tränen in den Augen.»
Ruth Angst erzählt mir diese Geschichte in allen farbigen Details. Sie hat sie in ihrem unverfälschten Wiler Dialekt aufgeschrieben und auch schon öffentlich vorgetragen.
Das Landei in der Stadt
Читать дальше