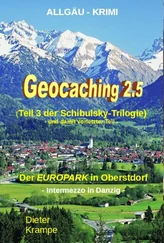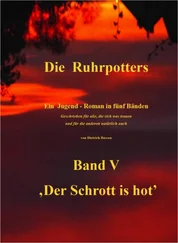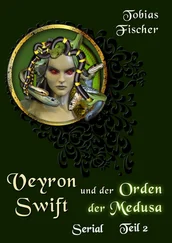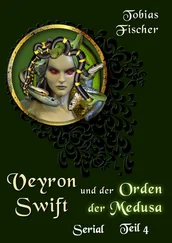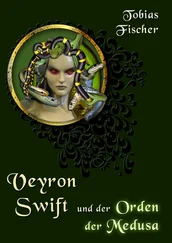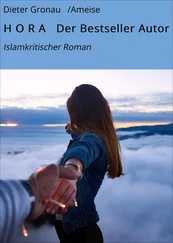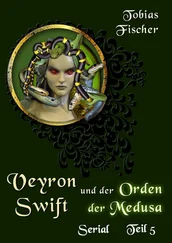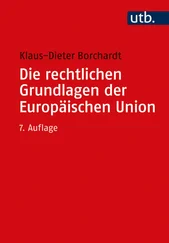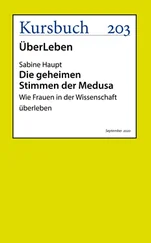Südsee.
Der Nachen hatte der Überfahrt von diesem Leben in ein anderes gedient. Dieses Leben war nur ein vorübergehendes, auf der andern Seite der See aber warteten die Geister der Ahnen, die, wie diese Seele hier, unsterblich waren. Die Insulaner gaben der Barke mit der Asche des Verstorbenen einen Stoß. Sie trieb aufs Meer hinaus und verschwand, entkam für immer, denn sie fuhr mit ihrem Passagier in eine andere Zeit, in einen andern Raum.
Wild war sitzen geblieben. Es spürte die Eile nicht, die ihn sonst immer weitertrieb, mahnte, obwohl er keine Eile hatte. Das Perrier war ausgetrunken. Sollte er sich, an diesem historischen Ort der Trinker und Chômeurs, nicht ein Glas Weißwein bestellen?
Der Kellner stand mit dem Rücken zu ihm. Als er sich umdrehte, übersah er Wilds erhobene Hand. Dann drehte er sich wieder weg. Wild, ein Gaststättenduckmäuser, wagte nicht, zu rufen.
Monsieur!, das hätte genügt. Aber sein «Monsieur» hätte keine Ausrufezeichen gehabt. Er hätte das gar nicht fertig gebracht, diesen einfachen Ton, der einen französischen Kellner in Bewegung setzt.
Garçon, konnte der Franzmann neben ihm sagen, halblaut bloß, und sofort rief der weit entfernt einen Tisch wischende Kellner: J’arrive!, Monsieur. Wilds «Monsieur?» tönte wohl so ähnlich wie «Lieber Herr Kellner, würde es Ihnen wohl etwas ausmachen, einen Augenblick zu mir herüber zu kommen; ich möchte bloß zahlen, Sie müssen mir nicht noch einmal etwas bringen, bitte sehr, bitte die Störung zu entschuldigen, gewiss haben Sie, und grad in diesem Augenblick, Wichtigeres zu schaffen …»
Die Contrescarpe lag nun im vollen Licht des Juni. Ohne dass Wild weiter etwas gesagt hätte, kam der Kellner an seinen Tisch.
L’addition, Monsieur?
Es ging gegen Elf. Alle Dunkelheit von damals vertrieben, ausgelüftet, verweht. Der Wohlstand, also Geld. Das neue Europa.
Wild bestellte nun doch noch ein Glas Weißwein.
Paris war eine dunklere Stadt gewesen, nicht nur nachts, als es noch finstere Gegenden gab hier, im historischen Zentrum. Es schien auch tagsüber grau zu bleiben. Grau, wo es heute weiß war. Geweißelt.
Ende der Fünfzigerjahre. Nicht viel mehr als zehn Jahre war es her, dass die Deutschen, die Besatzer, die durch die Stadt dröhnende, marschierende, lungernde Wehrmacht abgezogen war. Die Fotos von damals zeigten einen Schmerz im Gewebe der Stadt.
Damals schon, als er zum ersten Mal nach Paris gekommen war, war es für Wild unvorstellbar gewesen, dass sie es überhaupt gewagt hatten, die Hauptstadt der Franzosen, die Ville Lumière, zu besetzen. Einen Ort, von dem sie in ihren ernsten Städten nirgendwo auch nur einen Abglanz hatten.
Keinen blassen Schimmer von Charme und Eleganz des Art Déco mit seinen femininen Rundungen, die Deutschen, die mit ihrem Bauhaus die Welt über Schnittkanten definierten und, viel schlimmer, das alte Rom vor Augen, mit dem hitlerischen Nürnberg ihre morose Weltanschauung, ein Wort, das im Französischen bezeichnenderweise nur als «la weltanschauung» existiert, in Sandstein umgesetzt hatten. Oder hatten umsetzen lassen.
Was war das bloß für ein Spuk gewesen, diese Soldaten und Offiziere in Paris, die Wehrmacht samt Gestapo, mit ihrer eng uniformierten, wassergescheitelten, stiefelbewehrten, waffenknarrenden Soldateska?
Bert hatte die Zeit genutzt, um weitere Reisen zu unternehmen. Auch für Bert war die Aare nicht Fluss genug.
Von Basel war er auf dem Rhein mit einem Lastkahn bis Antwerpen gefahren. Wild bekam eine Ansichtskarte des Hafens, die mit einer mäandernden Tintenkrakelei übermalt war.
Bert war Gestalter, Wild eher der Intellektuelle. In den Museen, den Ausstellungen lernte er viel von Bert, vor allem das Sehen. Bert profitierte allenfalls ein wenig von Wilds wachsendem Hintergrundwissen. Als eine einzige Person wären sie vollständig gewesen. Als zwei Freunde teilten sie jede freie Minute.
Bert war einer von vielen jungen Künstlern und Gestaltern, einer jener Fotografen und Grafiker, die Anfang der Sechzigerjahre nach Paris kamen. Bert arbeitete in einer Grafikbude als Sachfotograf, in Montmartre, in der Nähe von Pigalle, Orwell Publicité.
Bert, der große Einzelgänger, hatte nun eine Freundin, Helen. Wild war neugierig.
Aber Bert zeigte Helen nicht vor. Es schien immer einen Grund zu geben oder einen Vorwand, weswegen Helen nicht verfügbar war. Sie war gerade in Deutschland, oder sie arbeitete.
Als Wild nicht nachgab, fuhren sie mit Berts blauem Deux Chevaux an die Rue Eugène Carrière, um sie abzuholen und mit ihr in ein Bistro zu gehen. Berts Bruder hatte ihm das Auto überlassen.
Helen war noch nicht fertig, als sie die Treppen heraufgekommen waren. Sie hatte sich die Haare gewaschen und saß nun, um sie zu trocknen, auf dem Boden, mit dem Rücken zu einem Heizungskörper, ein blaues Tuch wie einen Turban um den Kopf.
Paris war damals voll von Schweizern, Deutschen, Amerikanern, die in den grafischen Berufen, in Werbeagenturen und bei den Zeitschriften arbeiteten. Paris war die Hauptstadt der Kunst. Und die Ausländer beherrschten die Szene der angewandten Künste.
Wild hatte einige von ihnen zusammen mit Bert in der Brasserie Coupole oben am Boulevard Montparnasse kennengelernt. Die Schweizer hatten die Geldscheine locker in der Tasche, die knisternden riesigen Francs-Noten. Bert zog sie lässig aus der Brusttasche seiner Jacke.
So war auch Helen nach Paris gekommen, mit einer Mappe mit Zeichnungen aus ihrer Kunstschule in Wuppertal auf der Suche nach Arbeit. Eine zarte deutsche Blondine, eher klein; die hohen Absätze ihrer ausgesuchten Stöckelschuhe machten sie nicht viel größer. Sie war verletzlich, fraulich und schön, mit einem Augenaufschlag, der ihre blau getönten Lider wie zwei Markisen langsam über den strahlend grünen Augen hochgehen ließ.
Ein Kriegskind ehedem. Im Nachkriegsdeutschland, aus dem sie kam, hatte sie wohl ihren Willen erworben; sie war aus dem Geschlecht derer, die niemals aufgeben. Zäh, mit einem jederzeit aktivierbaren Potenzial an Verzicht. Es ging bei ihr immer auch ohne, wenn es sein musste; ohne Geld und, wenn es sein musste, ohne den Andern.
Der väterliche Teil ihrer Familie war eine oder zwei Generationen vor ihrer Geburt aus dem slawischen Osten gekommen, der damals noch deutsches Reichsgebiet war. Eigentlich hätte das katzenhafte Elena gut zu ihr gepasst. Später in Rom, als sie die «Signora» geworden war, die sie immer schon gewesen war, wurde sie für die neuen römischen Freunde doch noch eine Elena. Lebenslang blieb ihr im Deutschen aber die Helene erspart.
Manchmal machte einer eine Anspielung auf Faust und die klassische Helena. Darauf wusste sie Entgegnung.
«Finden Sie nicht auch, dass Goethe unendlich überschätzt wird?»
Worauf am Tisch, nach einigem Staunen, sofort die Kontroverse ausbrach.
In ihrer eigenen Familie sagten alle Lena zu ihr. Hatte Wild mit ihr später eine Auseinandersetzung, wollte sie weder Lena noch Helen hören, dann wollte sie eine vollständige Helena sein. Das musste sie nicht aussprechen, klar war das allemal.
Nach ihrer Scheidung von Wild nannte sie sich Helen, nahm aber ihren Mädchennamen nicht wieder an.
Helen war in Paris von Agentur zu Agentur gezogen mit ihrer Mappe. Kreuz und quer durch die Stadt, in der Metro, die riesige Mappe unter dem Arm. Der Untergrundbahn, in der sie angestarrt, angerempelt und angefasst wurde und bald ihr Gesicht mit einem Tuch verhüllte, sich wie eine polnische Magd verkleidete, wie sie sagte.
Sie klapperte die halbe Stadt ab, la sacrée allemande, und sie bekam ihre Stelle, in Montmartre, in einer der Straßen, die vom Pigalle zum Moulin de la Galette hinaufgingen, einer ehemaligen Guingette, einem Tanzlokal, in welchem immer schon Künstler verkehrt hatten, von Renoir und Pissarro zu Van Gogh und Picasso. Da fand Helen Arbeit in jener kleinen Agentur, an jener Rue Germain Pillon, um genau zu sein, für die auch Bert arbeitete, bei Orwell Publicité.
Читать дальше