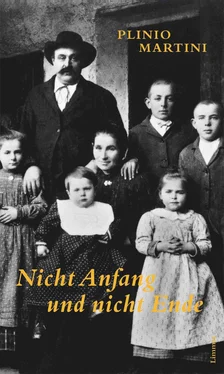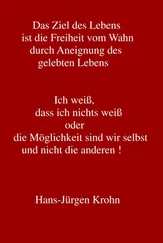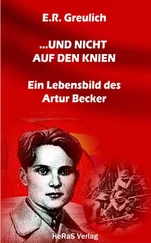Ich erinnere mich, wie einmal bei den Tuni Zwillinge starben. Heute geht es den Tuni gut, aber damals herrschte dort das nackte Elend. Von Giovanni, der so alt war wie ich, erzählte man, wenn die Mutter ihm seine Schnitte Brot gäbe, hielte er sie vor die Augen und riefe: «Mamma, ich kann dich sehen!» Es gab dort schon ein Dutzend durchzufüttern, und dann kamen zwei auf einmal, die man wahrhaftig nicht mehr brauchte. Geduld, Geduld! Die Kinder schickt der liebe Gott. Nur hatte die Mutter bei der Geburt so viel Blut verloren, dass die anderen Kleinen, die in der Küche spielten, es unter der Kammertür hervorsickern sahen und um Hilfe riefen. Der Vater war das Vieh besorgen gegangen und die älteren Geschwister in der Schule. Die Nachbarn kamen und fanden die Frau bewusstlos neben den zwei Neugeborenen. Die Tuni hatten freilich nicht die Mittel, sie aufzufüttern, damit sie die Zwillinge ordentlich nähren könnte, und damals gab es noch kein Nestlé-Kindermehl oder zumindest nicht für solche Leute. Nach ein paar Wochen, es war gerade Frühling, bekamen die Zwillinge Bronchitis. Tag für Tag wurde ihr Atem kürzer. Es sei eine Qual, sie röcheln zu hören, hieß es, hoffentlich würde der Herrgott bald einmal herunterschauen. Und wirklich: Das erste starb. Die Totenwache hielt man im Haus ihrer Tante Carolina ab, weil dort mehr Platz war, und während wir bei ihm wachten, starb auch das zweite. Da sagte der Vater zur ältesten Tochter, jetzt könne sie wenigstens das Bündel gerade auch noch zur Carolina hinübertragen und neben das andere legen und das Tedeum singen lassen.
Und wir sangen ein Tedeum wie am Jahresende.
Nämlich, um dir die Sache zu erklären, beim Gottesdienst zu Sankt Silvester schmetterten wir dir ein Tedeum, wie ich es später nie wieder gehört habe. Wir sahen Don Giuseppe in seinem festlichsten Messgewand herauskommen, und seine zittrige Hand erschien im Weihrauchnebel größer als sonst. In diesem bläulichen Nebel sangen wir vor dem Allerheiligsten. Ja, wir preisen dich, Gott, für das gute Jahr, weil es eine Gnade ist, oder für das schlechte Jahr, weil es eine Gnade ist, dass es nicht noch schlimmer kam. Wir preisen dich für die Kastanien und die Rüben und die Wassersuppe. Wem die Kuh abgestürzt ist, der preise dich, weil das Kalb nicht hinterherstürzte. Schließlich hatten wir sämtlich Anlass, ihn zu preisen, die Gesunden, die Verwaisten, die Kranken und die Hungrigen, weil wir noch am Leben waren und die Last jener weiterschleppen durften, die das Zeitliche gesegnet hatten.
Doch besonders gut passte in unserem Jammertal das Tedeum für die Kinder, die kaum geboren starben, da doch die ersten Erinnerungen jener, die davonkamen, unweigerlich mit einem schrecklichen Erlebnis oder einem Begräbnis begannen, wie es ja auch bei mir der Fall ist.
Antonio und ich blieben im Herbst allein in Roseto, um den Mist auf die Felder zu verteilen oder an den Waldrändern Holz zu machen. Die Arbeit war schwer, aber nicht so anstrengend, dass man dabei nicht hätte reden können, und tatsächlich sprachen wir den ganzen Tag miteinander. Der eine sagte etwas, und der andere antwortete ihm vielleicht eine halbe Stunde später.
«Im Mist geboren», sagte ich, als wir uns auf der Wiese begegneten, wo wir unsere Last tauschten, und stellte die leere gerla zu Boden. «Das ganze Jahr stecken wir drin, und wenns kein Mist ist, sind es Steine oder Dornenhecken. Dabei gibts auf der Welt Gott weiß wie viele Länder, wo man es leichter hat.»
Er setzte seine gerla auf der meinen ab, zog die Arme aus den Tragriemen und holte tief Atem. Während ich meinerseits unter die Last kroch, zitierte er:
«In Nachbars Garten ist das Gras grüner.»
Zum Teufel mit den Sprichwörtern! dachte ich bei mir und ging. Kräftig, wie ich damals war, machte mir eine Ladung Mist wahrhaftig nichts aus.
Aber schon beim bloßen Wort «Roseto» verzog ich bitter den Mund, wenn ich wie jetzt, als der neue Haufen sich zu den anderen reihte, rings um mich schaute und sah, mit welch unendlicher Mühe unsere Alten hier ein bisschen Erde zusammengekratzt hatten, gerade genug, um nicht hungers sterben zu müssen. Sie hatten an unzugänglichen Stellen Sennhütten und Wege gebaut, um die Wiesen und für die sòstene kilometerweise Mäuerchen errichtet, den Fluss und die Wildbäche eingedämmt und sogar Erde auf die größeren Felsblöcke hinaufgeschleppt, um ein paar Gemüsebeete anzulegen oder ein Stückchen Wiese, das vielleicht eine Hand voll Heu lieferte. Jahrhundertelange, beharrliche Mühe, und dann rutschte der Berg ab, kaum dass man Zeit hatte, ein Ave zu sagen, oder das Hochwasser durchbrach die Dämme, fegte die Felder hinweg und riss die ganzen Ställe mitsamt dem Heu und den Kühen mit sich fort. Wenn der Fluss heute keine Verheerungen mehr anrichtet, so nur, weil er uns schon alles angetan hat, was in seiner Macht stand, das sage ich dir.
Die wenigen Nachrichten, die unsere Vorfahren uns überliefert haben, betreffen nur Unglücksfälle; wie in Fontana, wo auf einem Felsblock mitten im Geröll ein Aufschrei eingehauen ist, von dem man nicht weiß, ob er ein Gebet oder einen Fluch bedeuten soll: «Jesus Maria, hier war schönes Land!» Damals hatten sie nicht genug Atem, um mehr zu sagen.
Von Sabbione über Ritorto bis Frodone – dieses zwei Kilometer lange Stück, wo der Talboden sich verbreitert, war zur Zeit unseres Großvaters noch Ackerland, das schönste im Bavonatal, wie er erzählte. Die Straße führte durch Gras und Roggen, Wiesen und Felder zu beiden Seiten, die Kühe versuchten, die Mäuerchen zu überklettern. Die Überschwemmung vom Jahr achtundsechzig hat alles fortgerissen. Stell dir nur unsere Alten vor, wie sie hingingen, sobald die Sonne wieder schien, um sich das Unglück zu besehen, ihre Gesichter, als sie dort, wo sie geackert und gedüngt hatten, nur noch Geröllhalden erblickten. Nicht einmal die Grenzsteine konnten sie wiederfinden. Manchen blieb nichts anderes übrig, als heimzugehen und ihr Bündel zu schnüren. Und so war es in Roseto, in Sonlerto, in Bolla; sogar von Gannariente heißt es, dort sei einst gutes Land gewesen.
Hin und her mit unseren Traglasten, und während sich die Reihe der Häufchen verlängerte (nachher musste man sie noch ausbreiten), kaute ich an diesem und ähnlichen Gedanken herum. Ich dachte an die von der letzten Überschwemmung stammenden Sand- und Schutthalden von Ritorto, wo man bei jedem Schritt aufpassen musste, wohin man den Fuß setzte, und fluchte halblaut vor mich hin:
«Ein Land für die Vipern!»
Antonio zuckte die Achseln. Wir hatten eine Weile lang schweigend unsere Arbeit verrichtet, aber er verstand, welcher Gedankengang mich so weit geführt hatte. Antonio zuckte die Achseln, weil er sanften Gemütes war und sich die Lehren von Don Giuseppe zu Herzen nahm: Unglück gab es für alle genug, auch für die Reichen und überall auf der Welt; wir hatten keineswegs ein Monopol darauf. Er sagte:
«Bei uns gibts wenigstens kein Erdbeben.»
Für ihn sah die Welt eben so aus. Das Leben war für alle schwer, das kam von der Erbsünde. Das Paradies musste man sich erst erwerben. Ich aber behauptete, anderswo wäre es besser; wenigstens brauchten die Leute ihre Kinder nicht großzuziehen, um sie dann wegzuschicken, wie unsere Eltern es tun mussten. Wer aber keine hatte, blieb im Alter allein wie ein ausgesonderter Ziegenbock und endete, wenn er seine ganze Habe verkauft hatte, bei der Fürsorge – und was eine arme Gemeinde wie unsere an Unterstützung geben konnte, war gerade genug, um nicht zu verhungern. Freilich, meinte Antonio, aber man müsste das Leben nehmen, wie es eben käme; wer höher hinauswollte, riskierte nur, es noch schlechter zu treffen; wer sich begnügt, der ist zufrieden, und man braucht sich nicht den Kopf zu verbinden, bevor er zerbrochen ist. Dann hielt ich ihm als Beispiel Locarno vor, wo die Leute auf ebenem Boden herumgingen und ruhige Gewerbe betrieben, die ihnen etwas eintrugen, ohne dass sie sich so plagten wie wir; in Locarno hätte man uns als Eindringlinge betrachtet, doch nach Amerika könnten wir, wenn wir Lust hatten, auf der Stelle auswandern.
Читать дальше