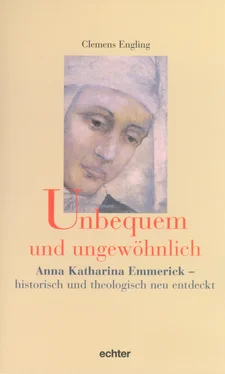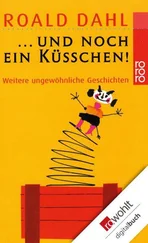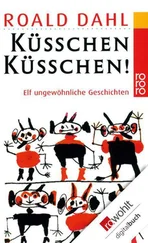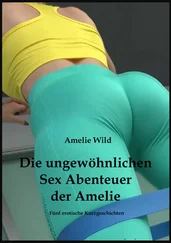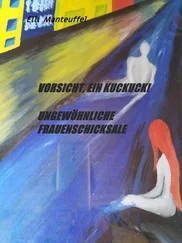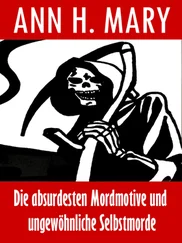Die Gestalt der Emmerick, die Guitton als »unerklärlichen Diamanten« bezeichnete, verlangt danach, erschlossen, ja entdeckt zu werden wie ein wertvolles Kunstwerk oder gar eine Ikone. Der früher in Dülmen geläufige Name »Anntrinken« weist aber darauf hin, dass ihre Person doch auch von großer Einfachheit und Zugänglichkeit für alle ist. Durch die Seligsprechung hat sie neuen Zuspruch erfahren. In einer Zeit, da Esoterik hoch im Kurs steht, könnte Emmerick sogar einmal sehr aktuell werden. Allerdings wird ihre tief integrierte Frömmigkeit immer in die Mitte des Glaubens weisen.
Bei meiner Verabschiedung in Dülmen als langjähriger Pfarrer der Grabeskirche habe ich der Gemeinde Hl. Kreuz versprochen, einen ausdrücklichen Beitrag zur Neuentdeckung Anna Katharina Emmericks, die ich oft als »prominentestes Gemeindemitglied« bezeichnete, zu leisten. Das soll im Hauptteil in drei Schritten geschehen:
I. Ihr Leben im historischen Kontext (Kurzbiographie).
II. Perspektiven einer theologischen und geistlichen Existenz.
III. Ihre Bedeutung für die Gegenwart.
Im Schlussteil werde ich Zeugnisse der Geschichte von damals bis heute zusammenstellen.
1Dazu trug wesentlich die »Studie von Jean Guitton, übersetzt von Grete Schött« bei: »Anna Katharina Emmericks Aktualität« in: Anna Katharina Emmerick, Jesus mitten unter den Seinen, Kevelaer 1981, S. 299–313 und in: Emmerickblätter, Mitteilungen des Emmerick-Bundes e. V., an der Kreuzkirche 10, 48249 Dülmen (ab jetzt zitiert: Emmerick-Blätter) 1984 II, S. 6–15. – J. Guitton, geb. 1901, Mitglied der »Académie Française« wurde in Deutschland bekannt durch sein Buch »Dialog mit Paul VI.«, Wien 1967.
2M. Bangert, C. Engling, H. Flothkötter (Hrsg.), Anna Katharina Emmerick, Passio-Compassio-Mystik, Dokumentation des Emmerick-Symposions an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, Münster 2000, 9–25, S. 25 (ab jetzt zitiert: Symposion III).
3Schon ist zu Beginn der Karwoche 2005 ein IV. Symposion geplant mit dem bezeichnenden Titel: »Anna Katharina Emmerick: Spiritualität – Visionen – mystisches Erleben. Anregungen in Zeiten der Säkularisation« (Programmentwurf).
4Engling, Symposion III, S. 24. – Michael Bangert ist zunächst in einem Vortrag und dann in dem Aufsatz: «Entfremdet und entrückt. Ein Anweg zu Anna Katharina Emmerick«, in: Geist und Leben 2/1997, S. 108–125, den Gründen für eine verkürzte Historisierung und einseitige Stilisierung Anna Katharina Emmericks in Bild und Text nachgegangen. »Das romantische Konstrukt hat sich wie ein Kokon um sie gelegt« (ebd. S. 110). M. Bangert verweist auch auf die Negativwirkung der von dem Redemptoristen Carl Eberhard Schmöger herausgegebenen Emmerickschriften 1867–1870. Schmöger und die von ihm geförderte Louise Beck († 1879) wurden durch O. Weiß, Die Redemptoristen in Bayern (1790–1909). Ein Beitrag zur Geschichte des Ultramontanismus, St. Ottilien 1983, in ein überaus kritisches Licht gerückt. – M. Bangert behauptet: »Jedoch kann oder muss ihre (Anna Katharinas) Biographie ›gegen den Strich gelesen‹ werden, um ihre Subjektwerdung zu entdecken« (a.a.O. S. 119). – Diesem Rat ist Günter Scholz gefolgt in seiner sehr lesbaren Biographie: »Anna Katharina Emmerick, Kötterstochter und Mystikerin, Münster 2003.
5Peter Hünermann sagte gegen Ende seines Referates »Das religiöse Phänomen der Anna Katharina Emmerick im Umfeld der zeitgenössischen Theologie. Marginalien« (In: C. Engling, H. Schleiner, B. Senger/Hrsg., Emmerick und Brentano. Dokumentation eines Symposions der Bischöflichen Kommission »Anna Katharina Emmerick« Münster 1982, Dülmen 1983, S. 73–85): »Es wäre fatal, wenn der für Anna Katharina betriebene Beatifikationsprozess sich amalgamieren würde mit Restaurationstendenzen in der heutigen Kirche, die im Grunde auf eine Repristination jener Theologie abzielen, wie sie oben gekennzeichnet wurde, einer Theologie, die der mühevollen begrifflichen Auseinandersetzung mit dem in der Philosophie und in den Wissenschaften erreichten Niveau der Reflexion noch nicht voll mächtig war« (ebd. S. 85; ab jetzt zitiert: Symposion I).
6J. Guitton spricht in seiner Studie davon, man müsse »mit Sorgfalt bestimmen, wie der Dichter Clemens Brentano (einer der größten deutschen Romantiker, aufgewachsen in der Umgebung Goethes), guten Glaubens die mitklingenden Töne seiner gelehrten, symbolistischen und romantischen Bildung dem Zeugnis der Katharina Emmerick hat überlagern können« (Emmerickblätter 1984 II, S. 8).
7Vgl. meinen Aufsatz: »Brentano ›rettet‹ nicht mehr ›als ein paar arme Lappen‹. Mel Gibsons ›Die Passion Christi‹ und die Visionen nach Emmerick-Brentano« (in Emmerickblätter 2004 II., S. 8–16).
8In: C. Engling, H. Festring, H. Flothkötter (Hrsg.), Anna Katharina Emmerick – die Mystikerin des Münsterlandes. Symposion 1990 der Bischöflichen Kommission »Anna Katharina Emmerick, Münster, Dülmen 1991, S. 15–38, ebd. S. 22 (ab jetzt zitiert: Symposion II) – Pater Dr. Joseph Adam, Herz-Jesu-Priester aus Luxemburg, hatte 1990 eben die für den sog. Schriftenprozess erforderte historisch-kritische Vorlage (Positio) erarbeitet. Sie erschien, hrsg. von der Congregatio de Causis Sanctorum P. N. 1225 unter dem Titel: Monasterien Canonizationis servae Die Annae Catharinae Emmerick Monialis Professae Ord. Can. Reg. S. Augustini (1774–1824). Positio super virtutibus Vol I–III, Roma 1992 in französischer Sprache. Deutsch ist keine Prozess-Sprache. Es traf sich glücklich, dass Pater J. Adam als Luxemburger deutsch und französisch in vollkommener Weise beherrschte. Er war Deutschlehrer an einem ordenseigenen Gymnasium und in den fünfziger Jahren in Freiburg promoviert mit der nach wie vor sehr lesenswerten Dissertation: »Clemens Brentanos Emmerick-Erlebnis. Bindung und Abenteuer, Freiburg 1956. (Eine Neuauflage wäre wünschenswert!). – Nachdem am 24. 4. 2001 mit der Promulgierung des entsprechenden Dekretes durch Papst Johannes Paul II. der sog. Tugend- oder Schriftenprozess abgeschlossen und die von Pater J. Adam erstellte Positio anerkannt ist (vgl. Emmerickblätter 2001 II, S. 3–7), veröffentlichen wir entscheidende Passagen aus der Positio in Fortsetzung, das erste Mal in: Emmerickblätter 2003 I, S. 17–23.
9E. Klinger, Das Interesse Brentanos an Anna Katharina Emmerick. Dichtung und Religion, in: Symposion II, 123–139, S. 124.
10Um eben die Zeit, als Elmar Klinger beim zweiten Symposion in Münster seine Thesen vortrug, stellte Alexander Loichinger – die Verfasser wussten wohl nicht voneinander – in einem Vortrag in Dülmen fest: »Die Emmerick-Schriften haben bis heute fast ausschließlich germanistisches Interesse gefunden. Eine theologische Befassung blieb aus. Man kann die Emmerickvisionen sehr wohl theologisch-wissenschaftlich auswerten. Nur muss eines klar sein: das ist dann keine Theologie, die ursprünglich zur Emmerick gehört, sondern eine Theologie zu Werk und Dichtung Clemens Brentanos« (in: Dülmener Heimatblätter, Jg. 1991, Heft 3–4, S. 28). – Loichinger wie Klinger weisen auf ein Forschungsdesiderat hin, wenn auch mit unterschiedlichem Ansatz.
11W. Frühwald, Symposion I, S. 167. – Beim ersten (interdisziplinären) Symposion war es 1982 in der Diskussion zwischen Theologen und Literaturwissenschaftlern um die Frage gegangen, warum man so viel über Görres und Brentano, aber so wenig über Emmerick spreche, sodass Prof. Wolfgang Frühwald selbstkritisch feststellte, in der Brentano-Forschung werde die Person Anna Katharina Emmerick stark vernachlässigt und mehr als ein »Werkzeug der Erkundigung« gesehen, fast wie bei Brentano selbst (ebd.).
12Selbstverständlich zieht der Verfasser dieser Arbeit auch Auskünfte aus Brentano; vor allem, wo es um biographische Details geht – schließlich ist Brentano ein unmittelbarer Zeitzeuge wie andere. Seine Aussagen und Deutungen werden von uns gerade im 3. Hauptteil, in dem es um die Bedeutung der Emmerick geht, herangezogen.
Читать дальше