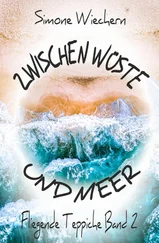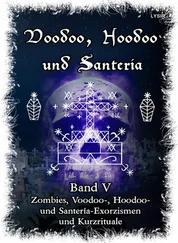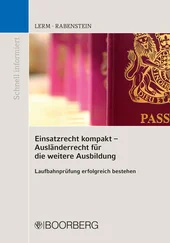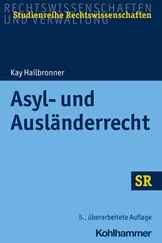Insgesamt zeigt diese kurze Übersicht, dass einzelne Gemeinden durch eine liberale Handhabung des Gesetzes den Problemdruck punktuell minderten. Davon abgesehen lässt sich die Akzeptanz oder Aneignung des Niederlassungsgesetzes von 1853 aber nicht mit messbaren Gemeindebürgerquoten erklären. Genauso wenig, wie relativ niedrige Bürgerquoten wie zum Beispiel in Chur bis um 1860 Widerstand gegen das Niederlassungsgesetz hervorriefen, wurde die konservative Gesetzesnorm nur dort gelockert, wo beispielsweise zu wenig Gemeindebürger für die Besetzung der Gemeindeämter vorhanden waren.
Während dieses Niederlassungsgesetz den Status quo nicht veränderte, gab es durchaus Gemeinden, die eine liberale Praxis walten liessen. In der Kantonshauptstadt hingegen wurde der Ausschluss der Niedergelassenen erst im Zuge der in weiten Teilen der Schweiz in den 1860er-Jahren entstehenden sogenannten Demokratischen Bewegung in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert. Auf der lokalen, nebenstaatlichen Bühne Churs, wo neben dem Churer «Bürger-Verein» einzelne Vorkämpfer und andere Vereine oder lose Gruppen auftraten, erhielt das bereits 1853 formulierte Argumentarium für oder gegen die Kontinuität der altrepublikanischen Partizipationsprinzipien auf beiden Seiten ganz explizit die Qualität bürgerlicher Werte. Der Anspruch, über bürgerliche Qualitäten zu verfügen, bildete in dieser Phase vielfach den Brennstoff der Diskussion. Die sich teilweise widerstrebenden Eigenschaften des «bürgerlichen Wertehimmels» – darunter die freie Meinungsbildung des Einzelnen oder das uneigennützige Engagement für das Gemeinwohl bei gleichzeitiger Sicherung des Eigennutzens – reklamierten die Akteure beider Seiten für sich und sprachen sie in teils polemischen Angriffen der Gegenseite ab.
3.2 Churer Spiessbürger in Bedrängnis
Die Stadt Chur gehört zweifellos zu den ersten Orten im modernen Kanton Graubünden, an denen das Rechtsverhältnis zwischen Nachbarn und Hintersassen zu Konflikten führte. Chur zählte schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts fast zwei Drittel Niedergelassene unter der Bevölkerung. 37Als Konsumenten, Wächter, Tagelöhner und schliesslich – bis zur Gewerbefreiheit von 1804 jedoch nur mit Bewilligung – als Handwerker waren sie seit Langem für die Stadt eminent wichtig. Bereits 70 Jahre vor dem Versuch des Kantons, das altrepublikanisch organisierte Rechtsverhältnis in den Gemeinden zu brechen, lassen sich 1804 erste Umrisse eines Aufbegehrens in der Beschwerde von Toggenburger und Saaser Schreinern und von einigen niedergelassenen Metzgern fassen. Der Stadtrat hatte Werkzeuge konfiszieren lassen, während den Metzgern von einigen Churer Gemeindebürgern der Laden aufgebrochen wurde. Die Geschädigten forderten beim kantonalen Grossen Rat die Respektierung der neuen Gewerbefreiheit seitens der Gemeindebürger und erhielten Recht. 38Als 1839 mit der Churer Zunftverfassung die letzte ihrer Art in der Schweiz abgeschafft worden war, blieben nur die Gemeindebürger in kommunalen wie kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt. 39Auch wenn diese Reform den Ausschluss der Niedergelassenen aus allen politischen Angelegenheiten Churs gar nicht infrage gestellt hatte, war die korporative Struktur der Stadt nach Abschaffung der Zunftverfassung in ihren Grundfesten erschüttert.
Im Folgenden möchte ich zeigen, dass eine intensive öffentliche Auseinandersetzung um das rechtliche Verhältnis zwischen Gemeindebürgern und Niedergelassenen in Gemeindeangelegenheiten erst in den 1860er-Jahren einsetzte. Die neue Entwicklung korrelierte mit der Demokratischen Bewegung, wie sie in zahlreichen Schweizer Kantonen zu dieser Zeit verstärkt fassbar wird. Erstmals tauchte der Begriff der Demokratischen Bewegung 1854 im Kanton Zürich auf, in den 1860er-Jahren erfasste diese Strömung unter anderem die Kantone Genf, Waadt, Basel-Land, Bern, Luzern, Aargau, Schaffhausen oder Thurgau. Der Forderungskatalog der Demokratischen Bewegung war gross und enthielt neben ökonomischen und sozialen Postulaten im engeren Sinn politische Forderungen wie direktdemokratische Verfassungsrevisionen und die Erweiterung des Stimm- und Wahlrechts. 40Nach und nach konnte die Demokratische Bewegung in den 1860er- und 1870er-Jahren «mit dem Ausbau der Volksrechte und schliesslich mit der Verfassungsrevision von 1874 das politische System in verschiedenen Kantonen und im Bund» 41noch weiter öffnen.
Graubünden gilt in der Schweizer Geschichtsforschung gemeinhin nicht als Kanton, der von der Demokratischen Bewegung erfasst wurde. 42Dass dem doch so ist, zeigt nicht nur die Tatsache, dass vor allem die katholische Surselva ab Mitte der 1860er-Jahre versucht hat, sich direktdemokratische Partizipationsmittel für ihre antimoderne Politik zunutze zu machen, wie Ivo Berther gezeigt hat. 43Daneben gab es eine Reihe mehr oder minder liberaler Versuche, die rechtliche Stellung der Niedergelassenen zu verbessern. Die Impulse dazu kamen aus Chur und betrafen meist die Kantonshauptstadt, wobei der Problemdruck wiederum kaum mit der Entwicklung des Anteils Niedergelassener in Verbindung gebracht werden kann. Deren Quote war im Vergleich mit 1806 nur unwesentlich von 65 auf 73 Prozent gestiegen. 44
1860 reichte der in Chur niedergelassene Anwalt Julius [Geli] Caduff aus Schluein (Surselva) mit 44 namentlich benannten «Angehörigen» und 31 weiteren Unterzeichnern eine Petition an den Bundesrat ein. Darin wurde das Begehren gestellt, das eidgenössische Heimatlosengesetz von 1850 so abzuändern, dass die Angehörigen einer Gemeinde in der Nutzung des Gemeindevermögens den Gemeindebürgern gleichgestellt seien, sowohl in Bezug auf das Nutzungsvermögen als auch auf die Bürgerlöser. 45Angehörige waren aufgrund des Heimatlosengesetzes aufgenommene Heimatlose, 46die gegenüber Niedergelassenen einige Rechtsprivilegien, aber ebenso wenig kommunale Stimmrechte noch Anspruch auf das Gemeindevermögen hatten. 47Die Träger dieser Petition entsprachen dem Muster der Demokratischen Bewegung in anderen Kantonen: Während die programmatische und organisatorische Führung bei den Bildungsbürgern lag, bestand die Bewegung aus Kleinbürgern, Bauern und Arbeitern. Im Churer Fall finden sich die Berufsbezeichnungen Schuster, Holzhacker, Zimmermann, Buchdrucker oder Hafner. 48
Vier Jahre nachdem dieser Petition nicht entspro – chen worden war, liess Julius Caduff in der Churer Schnellpresse von Senti & Hummel das 68-seitige Büchlein Die Einwohner-Gemeinde drucken, in dem er für die politische Notwendigkeit der Bildung von Politischen Gemeinden argumentierte. 49Im folgenden Jahr reichten 18 Niedergelassene der Stadt Chur ein erfolgloses Bittgesuch an die Schweizerische Bundesversammlung, in dem sie forderten, dass das Stimmrecht in Gemeindeangelegenheiten zum Bundesgesetz gemacht werde. 50Nur ein weiteres Jahr später sah sich der Stadtrat selbst zum Handeln veranlasst. Erneut tauchte Peter Conradin von Planta als Akteur im Umfeld dieser Fragen auf. Inzwischen war von Planta Churer Stadtrat, und ihm fiel die Aufgabe zu, eine neue Stadtverfassung zu entwerfen. 51Gemäss seinem Vorschlag sollten die Niedergelassenen eine Minderheit im Kleinen und Grossen Stadtrat stellen dürfen, sodass diese wachsende Gruppe in der verschuldeten Stadt mit verhältnismässig hohen Steuern 52ein gewisses Mitspracherecht erhalten hätte. 53Die Vorlage scheiterte genau wie eine weitere im Jahre 1867, und das Projekt einer Einwohnergemeinde im Februar 1868. 54
Da es nicht gelang, einer neuen Norm via Verfassung zur Stabilität zu verhelfen, versuchte die Stadtverwaltung nun, mittels Einbezug von Vorschlägen der Gemeindebürger, einen Konsens zu erreichen. Auf den Aufruf des Stadtrats vom 2. Mai 1868 im städtischen Amtsblatt reichten der Anfang 1868 neu gegründete Bürgerverein, der Kleine Bürgerverein, der Reformverein, 55der Arzt Thomas Gamser und Stadtpfarrer Christian Kind ihre Vorschläge ein. Während dem späteren Churer Bürgermeister Gamser, dem Reformverein und dem Kleinen Bürgerverein eine Politische Gemeinde mit überwiegender Vertretung durch die Gemeindebürger und Ausscheidung des Nutzungsvermögens vorschwebte, sprach sich der Bürgerverein gegen eine Politische Gemeinde und lediglich für die Herabsetzung der Einbürgerungstaxen aus. 56Auf Grund der Vorschläge unterbreitete der Stadtrat knapp zwei Jahre später eine Vorlage für den erleichterten Bürgereinkauf zur Abstimmung. Der Erfolg dieses angenommenen Gesetzes war bescheiden, der längerfristige Zuwachs der Bürgerquote betrug nur 3,5 Prozent. 57Gleichzeitig nahm sich der in Chur erscheinende Bündner Kalender der Frage an und forderte, den Niedergelassenen sei gleich den Gemeindebürgern gegen Entgelt die Nutzung des Gemeindevermögens zu ermöglichen. 58
Читать дальше