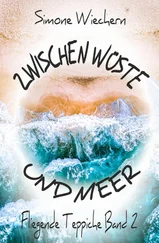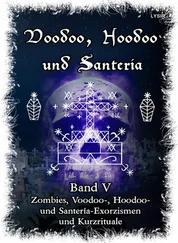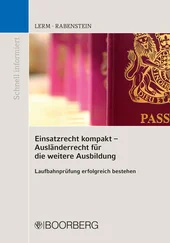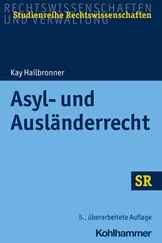Neben diesen Handlungsmöglichkeiten Einzelner zeigen die im Diskurs von 1868 hervorgetretenen Bürgervereine und der Reformverein, wie nach der Entgrenzung der Stadtbürger aus Bindungen wie den Zünften neue politische Handlungseinheiten entstehen konnten. Bereits 1842 gründeten einige Churer aus «Mangel an Einheit unter uns» den ersten Churer Bürgerverein. Der «Wunsch des Gedankenaustausches, Bürger gegen Bürger und Bürger gegen Obrigkeit», sei «gross und mannigfaltig», stand in den ersten Statuten. Der Zweck dieses ausdrücklich nur den Churer Gemeindebürgern offenstehenden Vereins war sehr allgemein umschrieben: «[A]ller Art gemeinnützige Gegenstände in unserem Gemeinwesen nach Kräften fördern zu helfen, um bei allfällig vorkommenden Übelständen von sich aus, sei es auf dem Wege der Einlagen oder des gesetzlichen Petitionsrechtes, gehörigen Orts einzukommen.» 101Dieser Versuch, mit einem Verein eine neue Identität nach innen und eine Abgrenzung nach aussen herzustellen, 102wurde auf eine möglichst breite Basis gestellt; jeder Gemeindebürger ab 18 Jahren hatte Zutritt zum Verein. 103Die strikte Abgrenzung nach aussen bedeutete im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen keine soziale Distinktion nach «oben» oder «unten», 104sondern potenziell einen Längsschnitt durch alle Schichten der Churer Bevölkerung: Die prekär gewordene rechtliche Stabilität nach Ende der über 350-jährigen Zunftverfassung sollte mit diesem frühen politischen Verein stabilisiert werden. Weitere Quellen zu diesem frühen Churer Bürgerverein fehlen jedoch gänzlich. 105Trotzdem lässt sich festhalten: Für Chur war ein politischer Verein als freie Assoziation aller Gemeindebürger etwas völlig Neues. Dies hatte es im vormodernen Chur, als die Stadtbürger gestützt auf ein kaiserliches Privileg aus dem 15. Jahrhundert via Zünfte das politische und ökonomische Leben regelten, nicht gegeben. 106Im weiteren Kontext der Bündner Politik ist der Churer Bürgerverein als eine der ersten konservativ ausgerichteten Vereinigungen im modernen Kanton Graubünden zu bezeichnen. 107Zentrales Anliegen war, den politischen Wahl- und Abstimmungskörper der Stadt Chur als Bürgerkorporation zu erhalten, weniger die Autonomie der Stadt gegenüber dem Kanton.
Wer aber waren die Träger dieses Bürgervereins, oder, mit anderen Worten: Welche Rolle haben die alten Eliten in dieser freien Assoziation in Chur gespielt? Die Frage scheint umso gerechtfertigter, da in Chur wie im übrigen Kanton Graubünden Mitglieder der 40 Familien der aristokratischen Führungsschicht des Freistaats 108die hohen Ehrenämter zwischen 1637 und 1798 mehrheitlich unter sich aufgeteilt hatten. Unter den wenigen namentlich bekannten Mitgliedern des Bürgervereins von 1868 (Risch, Honegger, Simmen, Lendi, Hatz und Kind) wurden zwei Familien (Simmen um 1855, Honegger um 1859) 109erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Churer Gemeindebürger. Risch, Lendi, Hatz und Kind gehörten zwar älteren Churer Geschlechtern an, Mitglieder der alten Bündner Führungsschicht waren aber auch sie nicht. Dabei lebte in den 1870er-Jahren durchaus noch eine Anzahl solcher Familien (die Bavier, die Salis, die Sprecher oder die Tscharner) in Chur. 110Dasselbe Bild ergibt sich im Übrigen auch für den nur aus Gemeindebürgern zusammengesetzten Stadtrat: Vergleicht man diese Behörde stichprobenartig mit sämtlichen Familien, die zwischen 1637 und 1798 mehr als ein hohes Ehrenamt besetzt haben, findet man für die elfköpfige Stadtbehörde von 1847 mit einem von Salis und einem (von) Bavier zwei, 111für jene 15-köpfige von 1872 mit einem (von) Bavier und einem Sprecher wiederum nur zwei Übereinstimmungen. 112Die alten Eliten verloren demnach in Chur im 19. Jahrhundert in den politisch relevaten Gremien rasch an Übergewicht. Hinweise, dass sie in freien Assoziationen wie dem Bürgerverein eine wichtige Rolle gespielt hätten, fehlen ebenfalls. Anders als in den Städten Bern oder Zürich kann deshalb von einem «Kampf [der neuen Eliten, S. B.] gegen die aristokratischen konservativen Herren und ihren Anhang» 113nicht die Rede sein. Demgegenüber betont die Forschung für die grossen ehemaligen Städteorte Basel und Bern eine Kontinuität der alten Eliten bis in das 20. Jahrhundert, die mit einer ausgeprägten Affinität zur vormodernen Tradition bis hin zum adligen Selbstverständnis einherging. 114
Dies heisst nun nicht, dass es im Kanton Graubünden des 19. Jahrhunderts keine politisch aktiven Mitglieder der alten Eliten gab. Nur war ihre politische Ausrichtung wahrscheinlich oft eine andere als in Basel oder Bern: Was bereits mit den politischen Handlungen Peter Conradin von Plantas angedeutet wurde, hat Adolf Collenberg verallgemeinert: «Gerade die alte Landaristokratie war hier Trägerin des liberalstaatlichen und wirtschaftlichen Fortschritts.» 115Anfang der 1870er-Jahre trat im Bündner Grossen Rat ein Akteur für die Rechte der Niedergelassenen auf, der für seinen Biografen – wiederum Peter Conradin von Planta – «unstreitig der bedeutendste bündnerische Staatsmann dieses Jahrhunderts» 116war: Andreas Rudolf von Planta aus Samedan im Oberengadin. Tatsächlich gilt Andreas Rudolf von Planta dank des Niederlassungsgesetzes von 1874 bis heute als «weitblickender Staatsmann», 117der eine für damalige Verhältnisse liberal-universalistische bürgerliche Gesellschaft dort zu realisieren versuchte, wo das bisher auf den Widerstand der Altrepublikaner gestossen war: in den Gemeinden.
In der ersten Hälfte der 1870er-Jahre startete der Kanton den zweiten Versuch, die Niederlassung neu zu ordnen. Mit einer Motion versuchte Grossrat Andreas Rudolf von Planta, die altrepublikanische Partizipationsstruktur zu zerbrechen. Mit dem daraus entstandenen Niederlassungsgesetz schnitt der Kanton tief in die altrepublikanisch organisierten Gemeinden ein und traf mit der zwingenden Erweiterung der Partizipationsberechtigung einen Teil der Gemeindeautonomie. Die Argumente der parlamentarischen Spezialkommission um Nationalrat Andreas Rudolf von Planta reproduzierten im Wesentlichen das aufgeklärt-liberale Argumentarium der 1850er- und 1860er-Jahre, ohne jedoch explizit bürgerliche Werte zu bemühen. Der Gesetzesentwurf erlaubte den Gemeindebürgern, nur mehr wenige ihrer Rechtsprivilegien zu behalten. So wollte man eine Trennung der politischen Rechte und der Rechte am Gemeindevermögen weitgehend vermeiden. Diese modernen Grundsätze wurden in der liberalen und katholisch-konservativen Presse als Garanten der Gemeindeeinheit hervorgehoben, während öffentliche Kritik am neuen Gesetz nur isoliert auftauchte.
3.3 Der Bruch mit der Hegemonie der Gemeindebürger
Bereits als Nationalratspräsident hatte der Oberengadiner Andreas Rudolf von Planta im Zuge der Demokratischen Bewegung Mitte der 1860er-Jahre auf Bundesebene einer grösseren direktdemokratischen Beteiligung das Wort geredet. Die neun Revisionspunkte der Bundesverfassung von 1866 hätten immerhin für alle Schweizer das Stimmrecht in Gemeindeangelegenheiten vorgesehen, doch scheiterte das «kunterbunte Paket von Vorschlägen» genauso wie die am 12. Mai 1872 knapp verworfene Revision der Bundesverfassung, die für die Niedergelassenen ebenfalls die kommunale Gleichberechtigung beim Stimmrecht vorgesehen hätte. 118Nicht einmal einen Monat später, am 8. Juni 1872, reichte Andreas Rudolf von Planta eine Motion an den Grossen Rat ein, die eine Revision des Niederlassungsgesetzes von 1853 verlangte. Damit verliess der Konflikt die lokale Bühne Churs und betrat zum zweiten Mal nach der Diskussion um das Niederlassungsgesetz von 1852 das Forum der kantonalen Behörden. Die Frontlinie, die sich damit auftat, war nun nicht mehr nur eine zwischen einer liberalen bürgerlichen Gesellschaft und einer altrepublikanischen Bürgergesellschaft, sondern gleichzeitig eine zwischen Etatisten und Altrepublikanern.
Читать дальше