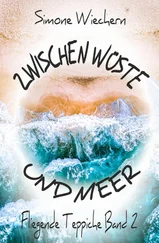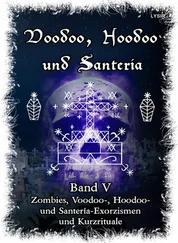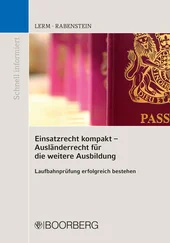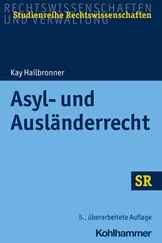Neben den vorgebrachten bürgerlichen Werten schien am Rande das Geschichtsbild der altrepublikanisch organisierten Korporation – im Falle Churs zielte das auf die Zünfte – als Garantin fundamentaler Werte auf. Der bürgerliche Sinn für das Gemeinwohl fusste danach auf einer Mischung von ahistorischen bürgerlichen Werten und historischer Leistung. Es brauche nämlich einen «feste[n] Kern», dem «Natur, Verfassung und Geschichte» die Lenkung der Gemeinde zusprechen würden. 83Dies war der «Kern von Menschen, der durch die Bande der Pietät und des dauernden Interesses» an das Gemeinwesen gebunden war. 84Solche antimodernen Positionen waren durchaus typisch für das Bürgertum, denn «seit der Romantik waren immer auch Bürger die schärfsten Kritiker der eigenen Ausgestaltung von Bürgerlichkeit». 85Das staatsrechtliche Projekt einer liberal-universalistischen bürgerlichen Gesellschaft zerstöre die bewährten Traditionen, 86lautete die Kritik der konservativen Bürgerlichen am Projekt der liberalen Bürgerlichen. Bereits im 18. Jahrhundert setzte die Romantik den Organismus dem mechanischen, rationalen Denken der Aufklärung gegenüber: «Natur, Staat und Gesellschaft bilden danach einen gewachsenen Körper, der sich nicht ungestraft in seine Bestandteile zerlegen lässt.» 87Diese Art der Verhaftung mit der Vormoderne, die darin nicht nur Gemeinsamkeit stiftende, abstrakte Tugenden und Helden sah, sondern konkrete, erhaltenswerte politische Institutionen, war in ihrem konservativen Gestus etwas dezidiert anderes als die Erinnerungsfeiern und der Historismus der freisinnigen Schweiz. 88Diese Kritik an der liberalen Moderne sollte in Graubünden, getragen von einer liberalen Rechten, aufseiten der Gemeindebürger in späteren Jahrzehnten noch um einiges elaborierter ausfallen – und sich gleichzeitig von der Formulierung bürgerlicher Werte entfernen.
Damit zurück zur Churer Debatte der 1860er-Jahre: Über den (gescheiterten) ersten Versuch der Einrichtung einer politischen Gemeinde in Chur 1866 schrieb die Bündnerische Volks-Zeitung höhnisch, der Stadtrat hätte sich «etwas weniger mit dem souveränen Bürgermantel drapiren» sollen, wenn er einen «Beweis von Bürgertugenden» hätte geben wollen, stattdessen sei ein «Gebräu von zwei Drittheil Bürgerlich-konservativer Engherzigkeit und einem Drittel [sic!] verdünntem Liberalismus» vorgelegt worden. 89Damit wird noch einmal deutlich, wie stark in den 1860er-Jahren Vorstellungen über die Ausgestaltung der modernen, kommunalen Staatsbürgergesellschaft mit Werten vermischt wurden, die man als «bürgerliche» erkannte. Tugendhaftes Verhalten zeichnete sich nach dieser Deutung durch «Bürgersinn» aus, dadurch also, dass man möglichst vielen stimmberechtigten Männern die Möglichkeit zur Partizipation am Gemeindeleben gab. Genau daran mangelte es gemäss dem Churer Bittgesuch von 1865 an die Schweizer Bundesversammlung, worin 18 in Chur niedergelassene Schweizer das Stimmrecht in Gemeindeangelegenheiten forderten. In ihrer Argumentation nahm der den Gemeindebürgern vorgeworfene «Eigensinn» tyrannische Züge an. In Graubünden betrachte man es, so schrieben die Petenten, «als historisches Recht und als gute Sitte, über die Niedergelassenen wie gewissermassen über eine rechtlose Menschenklasse zu herrschen und dieselbe finanziell auszunutzen». 90
Auch Julius Caduff argumentierte mit Werten des «bürgerlichen Wertehimmels». Sein Büchlein von 1864 über die Einwohner-Gemeinde zeigt, dass es in der Auseinandersetzung um die kommunalen Rechte von Gemeindebürgern und Niedergelassenen darum ging, allgemeinere Ideale wie egoistischen «Eigensinn» und gemeinwohlorientierten «Bürgersinn» den beiden sozialen Gruppen oder ihren Akteuren zuzuschreiben. Dem Argument der Gegner der politischen Gemeinde, wonach den Niedergelassenen jede Bürgertugend im Sinne von Gemeinwohlorientierung abgehe, hielt Caduff entgegen: Wenn die Bürgertugenden so sehr auf die Interessen der eigenen Gemeinde reduziert wären, dass sie schon im Nachbardorf inexistent wären, «dann wäre es wahrlich nur gut, wenn ein solches Spiessbürger- und Zopfthum sobald wie möglich ein Ende nähme!». 91Gemeinwohl wurde als etwas verstanden, was über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinausgehen sollte. Caduff favorisierte eine liberal-universalistische bürgerliche Gesellschaft, weil es ein «jedem Menschen innewohnende[s] Gefühl von Gerechtigkeit und Gleichheit» 92gebe. Diese liberale bürgerliche Gesellschaft ging nicht von einer am Gemeinderecht orientierten Korporation aus, sondern vom Individuum.
Eine bürgerliche politische Kultur in Chur
Einen unmittelbaren Effekt auf den Status quo in der Stadt Chur hatte der Widerstreit bürgerlicher Werte nicht. In der Debatte um die Rechte von Gemeindebürgern und Niedergelassenen der 1860er-Jahre war hingegen eine politische Kultur miterzeugt worden, die typische Merkmale von Bürgerlichkeit aufweist. Trotz ihrer unterschiedlichen politischen Haltung konstituierten die widerstreitenden Positionen eine genuin bürgerliche politische Kultur, die sich von einer Arbeiter- oder Bauernkultur unterschied. Dazu gehörte die «Orientierung am Ideal» 93des «bürgerlichen Wertehimmels» mit seinen abstrakten, inhaltlich offenen Prinzipien wie etwa dem «Bürgersinn», den man der Spiessbürgerlichkeit vorzog.
Darüber hinaus war die Möglichkeit, sich individuell oder im freien Zusammenschluss mit Gleichgesinnten politisch zu engagieren, eine wesentliche Strukturvoraussetzung von Bürgerlichkeit. Die Debatte um die Schaffung einer politischen Gemeinde in den 1860er-Jahren in Chur hat gezeigt, wie die Lokalpolitik zur Bühne wurde, auf der sich «parallel zu den sozialen Veränderungen der Gesellschaft eine Adaption und Erfindung neuer politischer Handlungsformen» 94vollzog. Zum einen werden diese im individuellen Vorgehen Einzelner fassbar, zum anderen als freie Assoziation Gleichgesinnter.
Zu den Bildungsbürgern, die sich auf dieser Bühne hervortaten, gehörten neben Ratsherr Peter Jakob Bauer Stadtpfarrer Christian Kind, der katholische, radikal-liberale Anwalt Julius Caduff, der radikal-liberale Arzt Thomas Gamser oder auch der gemässigt liberale Peter Conradin von Planta. 95Diese Akteure machen deutlich, wie der Kampf gegen das vorherrschende Deutungsmuster des Altrepublikanismus ein gewisses Mass an individuellem Handeln erforderte, um in der immer durch bestimmte Zwänge und Anforderungen geprägten «ungesellige[n] Geselligkeit der bürgerlichen Gesellschaft» 96neue Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen: So galt Caduff als «kernhafter Radikaler» – eine für einen Katholiken aus der Surselva bereits in den 1860er-Jahren durchaus untypische Positionierung. 97In Eigenregie legte er 1866 den Entwurf einer neuen Bundesverfassung vor, worin er unter anderem die Volkswahl des Bundesrats und das obligatorische Referendum forderte. 98Peter Conradin von Planta hatte nicht nur 1842 als 27-jähriger Anwalt mit wenigen Mitstreitern den liberalen Bündner Reformverein gegründet. In seinem für die Kantonsregierung ausgefertigten Commissionalbericht über den Vorschlag zu einer Gemeinde-Ordnung von 1854 war er ein früher Mahner der Gleichstellung der Niedergelassenen in Gemeindeangelegenheiten und schliesslich 1866 treibende Kraft der Vorlage für eine liberalere Stadtverfassung gewesen – wenn auch Letztere in der Presse als schlechter Kompromiss gescholten worden war. Nicht zuletzt aber hatte derselbe Peter Conradin von Planta bereits 1846 als junger Churer Stadtschreiber aus Empörung einen kritischen Artikel im Freien Rhätier geschrieben. Das, nachdem die Stadt einem ihrer Gemeindebürger, der in Italien zum Katholizismus konvertiert war, faktisch das Bürgerrecht entzogen hatte. 99Der Preis für seinen liberalen Einsatz, mit dem er individuelle Freiheitsrechte über die Werte der Churer Bürgerkorporation gestellt hatte, war hoch gewesen. Bei der nächsten Wahl hatte Peter Conradin von Planta zur Kenntnis nehmen müssen, «dass meine Tage als Stadtschreiber gezählt seien». 100
Читать дальше