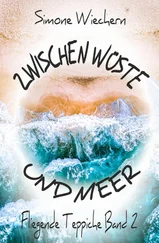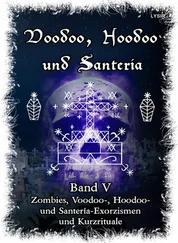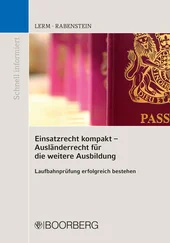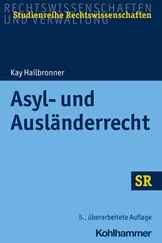Einige der eben summarisch beschriebenen Versuche, die rechtliche Stellung der Niedergelassenen in den Gemeinden zu verbessern, fallen nun besonders ins Auge. Wesentlich scheinen mir vor allem Julius Caduffs gedruckte Abhandlung von 1864, das Bittgesuch an die Schweizer Bundesversammlung von 1865, einige Zeitungsartikel von 1866 und 1868 und die gedruckte Broschüre mit den Vorschlägen der beiden Bürgervereine, des Reformvereins und von Stadtpfarrer Kind und dem Arzt Thomas Gamser. 59Mehr noch als in der Grossratsdebatte um das Niederlassungsgesetz von 1853 wird in diesem Spannungsfeld deutlich, dass die Frage der Exklusion oder Inklusion der Nichtpartizipationsberechtigten zur Frage um bürgerliche Werte schlechthin wurde. Gewisse bürgerliche Werte wurden zugunsten der Niedergelassenen oder der Gemeindebürger in Stellung gebracht, um die Stadt Chur hin zu einer liberal-universalistischen, bürgerlichen Gesellschaft zu öffnen oder den Status quo einer altrepublikanisch geprägten bürgerlichen Gesellschaft zu rechtfertigen – die man treffender vielleicht als Bürgergesellschaft bezeichnen müsste. 60Die Konstruktion dessen, was zum «bürgerlichen Wertehimmel» gehörte, war damit ein wesentliches Produkt des Diskurses, mit dem für oder gegen die Gleichstellung der Niedergelassenen gerungen wurde. Bürgerliche Werte konnten den Gemeindebürgern dabei durchaus streitig gemacht werden.
Im Folgenden möchte ich das an einem Zeitungsstreit vertiefen, ohne den Seitenblick auf die anderen Quellen zu verlieren. Der Konflikt entbrannte zwischen Peter Jakob Bauer und dem neu gegründeten Bürgerverein, nachdem das erwähnte Projekt einer Einwohnergemeinde im Februar 1868 von den Churer Gemeindebürgern verworfen worden war. Der Churer Ratssuppleant Peter Jakob Bauer 61sandte im März in sechs Folgen Betrachtungen und Ansichten über die Churer Gemeindwirren an die Bündnerische Volks-Zeitung ein. Er kritisierte, «einzelne Schichten bürgerlicher Bevölkerung» würden sich «in städtischer Politik sehr mangelhaft oder gar nicht orientiren». Im Vorfeld der Abstimmung vom Februar 1868 habe im Bürgerverein eine «gründliche Agitation» seitens der Gegner einer künftigen politischen Gemeinde stattgefunden, sodass «von Bildung einer selbständigen objektiven Ansicht nicht die Rede sein» könne. 62Eine liberal-universalistische bürgerliche Gesellschaft scheiterte in Chur gemäss Bauer einerseits am Bürgerverein, der als politisches Forum nicht demokratisch, sondern immer noch vormodern-oligarchisch funktionierte. Gravierend war für Bauer andererseits die Tatsache, dass die Churer Bürgerschaft aus zu vielen pedantischen Spiessbürgern bestand, die sich nur dann für städtische Politik interessierten, wenn es sich «um Loosholz, Gemeingüter oder Alpen» 63handelte.
Gemäss Peter Jakob Bauer blockierten diese Defizite die Überwindung altrepublikanischer Partizipationsstrukturen. Ein weiterer Missstand war für ihn, dass verfassungsmässig korrekt in Chur oft nur 100 bis 120 Gemeindebürger für das absolute Mehr bei Abstimmungen und noch weniger bei Wahlen genügten, um «über 7000 Seelen regieren» zu können. Dies stelle «widersinnige, nicht sonderlich republikanische Zustände» dar. 64Er forderte ein aufgeklärt-republikanisches Denken, wie es Napoleon im Nachgang der Französischen Revolution in die Helvetische Republik exportiert hatte: Dieses ruhte nicht auf abgeschlossenen kommunalen Korporationen, sondern auf einer viel universalistischeren bürgerlichen Gesellschaft. Gemäss Bauer wäre ein liberales Republikanismuskonzept ein Entwurf «im Sinne des Friedens und der billigen Berücksichtigung gerechter Wünsche der Niedergelassenen» 65gewesen.
Bauers publizistischer Angriff rief einen (wie es kurze Zeit später in der gleichen Zeitung hiess) «berühmt gewordenen Artikel» des Bürgervereins hervor, hinter dem sich M.[atheus] Risch, [Ratsherr Heinrich] Honegger, [Ratsherr Luzius] Simmen und A.[nton] Lendi verbargen. 66In ihrer Replik in der Bündnerischen Volks-Zeitung nahmen sie zunächst eine «persönliche […] Abfertigung» 67Bauers vor, bei der sie deutlich machten, dass er mit seinem Angriff die Grenzen des Sagbaren überschritten hatte. Es sei «einfach nicht wahr», dass man «nur prädisponierte und unsichere Leute» eingeladen habe, und «sodann hinter verschlossenen Thüren mit allen Mitteln einer schlauen Beredtsamkeit auf dieselben eingewirkt» habe, 68wie Bauer behaupte. Damit verteidigten sie die Fähigkeit der Churer zur selbstständigen Meinungsbildung, war doch nicht nur, so betont die Bürgertumsforschung, der «offene Zugang für alle» ein grundlegender bürgerlicher Wert, sondern auch «der kritische und freie Dialog untereinander». 69
Risch, Honegger, Simmen und Lendi bekräftigten auch, dass sie nicht am «Bürgerprinzip» festhielten, weil die Gemeindebürger ⅗ der Churer Steuern zahlten. 70Sie wehrten sich dagegen, die angegriffene Versammlung des Bürgervereins pauschal als «‹Zopf- und Philistertum›» bezeichnen zu lassen. 71Diese Begriffe tauchten inklusive dem des «Spiessbürgers» in Graubünden im Kontext des rechtlichen Verhältnisses von Gemeindebürgern und Niedergelassenen immer wieder zur Bezeichnung nur auf ihren «Eigensinn» fixierter Gemeindebürger auf. 72Spiessbürger waren, um mit dem Konservativen (!) Wilhelm Heinrich Riehl zu sprechen, «soziale Philister». Als solche hielten sie ängstlich am Überkommenen und am eigenen Reichtum fest, statt zu versuchen, im Sinne der «Bürger von guter Art» (Riehl) Neues zu schaffen. 73«‹Zöpfe, engherzige Philister, Krautbürger›» waren auch für die Mitglieder des Churer Bürgervereins abwertende Bezeichnungen für ängstliche, nur auf die Sicherung ihres eigenen finanziellen Vorteils bedachte Gemeindebürger, denen jeglicher «Bürgersinn» abging. 74Das zeitgenössische Pendant zum «Bürgersinn», das auch in der Bündnerischen Volks-Zeitung auftauchte, war der «Eigensinn», das eigennützige, am egoistischen Eigeninteresse orientierte Handeln. 75Ein zu hohes Mass an «Eigensinn», so stellt auch Manfred Hettling in seiner Analyse kultureller Normen des bürgerlichen Basels am Ende des 18. Jahrhunderts fest, «disqualifiziert den einzelnen geradezu, verhindert sein ‹Bürger-Sein›». 76Deshalb argumentierten die Mitglieder des Bürgervereins, ihnen gehe es vielmehr um «ideelle Motive». Diese liessen sich nicht «nach dem Franken und Rappen berechnen». 77Nur der Verband der Gemeindebürger sei nämlich «eine Quelle der Heimatliebe, der Hingebung und selbstbewussten Bürgersinns», was der blosse Wohnsitz nicht zu leisten vermöge, wie der Bürgerverein rund zwei Monate später in seinem Reformvorschlag an den Stadtrat präzisierte. 78
Dass diese Bürgergesellschaft nicht auf egoistischen «Eigensinn» reduziert werden konnte, sollte mit dem Vorschlag des Bürgervereins für eine «liberale […] Eröffnung» des Bürgerrechts untermauert werden. So trete «die republikanische Tugend der Billigkeit ins Mittel, gibt nach, wo sie eigentlich nicht nachzugeben braucht, opfert von dem, was ihr von Rechtswegen gehört 79und führt dadurch das schwankende Schifflein des Gemeinwesens wieder in sichern Port». 80Dass sie auch an die eigenen Interessen dachten, gaben Risch, Honegger, Simmen und Lendi natürlich zu. Einen massvollen Eigennutz machten sie genauso als bürgerlichen Wert stark, wobei ein gewisser, massvoller «Eigensinn», das heisst, so Manfred Hettling, «das Recht auf Eigentum und damit auch dessen Mehrung», als Gegensatz zum «Bürgersinn» durchaus Teil des «bürgerlichen Wertehimmels» war. Letztlich war es die «erstrebte Kombination dieser Eigenschaften», die das bürgerliche Ideal ausmachte. 81Deshalb könne es, so meinten die Vertreter des Bürgervereins, «nicht so weit gehen, dass man, um einem Anderen gerecht zu werden, sich selbst aufgibt; selbst der Schutzpatron Chur’s, der hl. Martin, der doch ein Heiliger war, hat nur die eine Hälfte seines Mantels weggegeben.» 82Das altrepublikanische Paradigma der korporativen Selbstverwaltung der Gemeinde wurde damit in den bürgerlichen «Wertehimmel» integriert, der mitnichten rückständig oder spiessig war, sondern den eigenen Besitz aus idealistischen Motiven sicherte.
Читать дальше