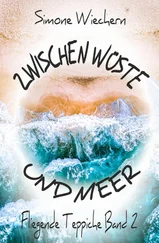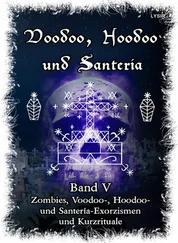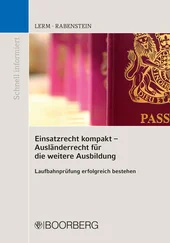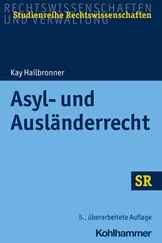In allen übrigen Angelegenheiten hatten die Gerichtsgemeinden das Referendumsrecht zwar zurückerhalten, konnten aber nicht mehr beliebige Kommentare und Alternativvorschläge anbringen, sondern nur noch mit Ja oder Nein antworten. 93Darüber entscheiden durften jedoch wiederum nur die Gerichtsbürger, wobei neben einem Bundesbürger- und einem Gemeindebürger- auch ein Kantonsbürgerrecht entstand. 94Während mit den Rechtsprivilegien von Gemeinden, Familien oder Amtsträgern wie dem Disentiser Abt die letzten «Requisite[n] der ehemaligen Feudaleinrichtungen» beseitigt wurden, blieben Niedergelassene von der Ausübung politischer Rechte ausgeschlossen. 95Die altrepublikanischen Staatsstrukturen der Vorhelvetik kamen bei der Partizipationsberechtigung wieder voll zum Tragen. Das demokratische Selbstverständnis blieb mehrheitlich korporativ orientiert, zentral war die «Gemeinfreiheit», die «libertad cumina», nicht der moderne Individualismus. Ein «moderner, liberaler Freiheitsbegriff wurde als Bedrohung von vertrauten politischen und gesellschaftlichen Verfahrensweisen empfunden». 96
Damit gerieten altrepublikanische Autonomievorstellungen von Anfang an in eine Frontstellung zum jungen Kanton Graubünden, der zwangsweise eine gewisse administrative und politische Zentralisierung durchsetzen musste, um neue Möglichkeiten der Entwicklung zu schaffen. Auf der einen Seite waren die Altrepublikaner, auf der anderen die liberalen Etatisten. Zu einer Zeit, als es noch keine modernen politischen Parteien gab, waren dies die Hauptströmungen der Bündner Politik. 97Während konservative Altrepublikaner versuchten, die administrative und politische Zentralisierung des Kantons zugunsten der Gemeindeautonomie so niedrig wie möglich zu halten, 98trachteten liberale Etatisten danach, den Kanton «als lenkende und innovative Instanz handlungsfähig zu machen». 99Letztere vertraten ein neues Republikverständnis, das an die Französische Revolution anknüpfte. Es favorisierte eine individualistisch-kapitalistische bürgerliche Gesellschaft, die eine «scharfe Trennung von Staat als Inbegriff des Politischen und Gesellschaft als ‹System der Bedürfnisse› ökonomischer Natur» vornahm. In dieser Vorstellung eines von der Wirtschaft prinzipiell getrennten Staats sollten beide Bereiche zumindest all jenen Männern offenstehen, die über ein gewisses Mass an Besitz und Bildung verfügten. 100Angesichts dieser Polarisierung blieb die Rede vom «Republikanismus» nicht nur in Graubünden bis ins 20. Jahrhundert ein ambivalent gebrauchter Begriff zwischen modernem und vormodernem Verständnis. 101Es wäre jedoch falsch anzunehmen, dass die liberal-etatistische Haltung prinzipiell nur die Sache von wenigen Intellektuellen oder von einigen wenigen Mitgliedern der Kantonsbehörden war, während sich die Altrepublikaner auf die geschlossene Zustimmung der Gerichtsgemeinde-Stimmen verlassen konnten: Als etwa der Grosse Rat 1834 versuchte, die Bestimmung der Kantonsverfassung aufzuheben, wonach für eine Verfassungsrevision eine Zweidrittelsmehrheit der Gemeindestimmen erforderlich war, wurde mit 32 zu 32 Stimmen das notwendige Mehr um nur eine Stimme verpasst. 102
Substanzielle Reformversuche gelangen trotzdem nicht. So blieb die Entwicklung lange Zeit eine zaghafte, die «Fahrt im liberalen Wind» ohne stürmischen Regenerationsschub in den 1830er-Jahren «gemächlich». 103Zwar versuchte der Grosse Rat in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts mit einer Fülle von Verordnungen und Reglementen auf dem Wege des Landespolizeirechts im Bereich Sanität, Transit, Schulen, Militär, Kirchen, Jagd, Strassenbau oder Forstpolizei, den Staat auszubauen. Liberale Etatisten wie der Jurist Peter Conradin von Planta kritisierten dennoch den «Korporationengeist» und forderten eine Überwindung des «Egoismus und Vereinzelungswesens». 1041841 gründete von Planta in Chur den Reformverein. 105Dieser sah das staatliche Ungenügen vor allem in der Autonomie der alten Gerichtsgemeinden, im veraltet-unübersichtlichen Gerichtswesen und in der schwachen Regierung. 106Die 1843 von Peter Conradin von Planta erstmals herausgegebene Zeitung Der freie Rätier diente der populären Aufklärung seiner Leser und behandelte Reformpostulate aus den Sparten Wirtschaft, Waldwesen, Verbauungswesen, Schulwesen oder Armenwesen. 107Der Verfassungsentwurf des Reformvereins von 1845 sah das erste Mal seit der Zeit der Helvetik eine Normierung des Gemeindewesens vor, dies betraf jedoch nur die Verwaltung, ohne die Rechtsstellung von Gemeindebürgern und Niedergelassenen zu tangieren. 108Die Spannung zwischen dem modernen Kanton und den alten Gemeindestrukturen war also noch, vereinfacht gesagt, ein Problem zwischen dem Kanton und der Autonomie der Gemeinden, nicht eines zwischen dem Kanton und den Gemeindebürgern als alleinigen Trägern dieser Gemeindeautonomie.
Nebenbei deutet dieser kurze Abriss der modernen Verfassungs- und Rechtsgeschichte Graubündens bereits an, wie sich im 19. Jahrhundert ein politisches Feld im heutigen Sinne konstituiert hat. 109Der Wandel der politischen Strukturen wurde zum Aushandlungsprozess. In den drei folgenden Kapiteln soll gezeigt werden, wo, wann und warum das bestehende Rechtsverhältnis zwischen Gemeindebürgern und Niedergelassenen das wurde, was es im Ancien Régime nie gewesen war: ein Problem, um dessen Lösung verschiedene Kräfte auf verschiedenen Bühnen gerungen haben.
3 Vom Niederlassungsgesetz 1853 zum Niederlassungsgesetz 1874
Der Aushandlungsprozess um eine Ausweitung der kommunalen Partizipationsrechte auf alle Schweizer begann in Graubünden mit der Debatte um das kantonale Niederlassungsgesetz von 1853 im Grossen Rat. Damit standen zwar nicht einzelne Kompetenzen der Gemeindeautonomie zur Diskussion. Der Versuch, die korporativ abgeschlossenen Wahl- und Abstimmungskörper der Gemeinden drastisch zu erweitern, rief dennoch den Widerstand altrepublikanisch gesinnter Grossräte hervor. Bereits in dieser frühen Phase wird ein Grossteil des Argumentariums fassbar, das phasenverschoben und in weitaus elaborierterer Form bis weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts von den Verfechtern der Rechtsprivilegien der Gemeindebürger vorgebracht werden sollte. Das seit dem frühen 19. Jahrhundert bestehende Spannungsverhältnis zwischen einem modernisierenden Kanton und den altrepublikanischen Prinzipien der Gemeinden kam jedoch noch nicht explizit zur Sprache.
3.1 De jure ein Status quo
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr die staatsrechtliche Gestalt des Kantons «auf einen Schlag eine fundamentale Veränderung». 1Mit dem neuen Gebietseinteilungsgesetz vom 1. April 1851 war es den liberalen Grossräten gelungen, die noch aus der Frühneuzeit stammenden Gerichtsgemeinden aufzulösen. An ihre Stelle traten die 39 neu geschaffenen Kreise, die aber lediglich gewisse gerichtliche Kompetenzen erhielten. Die eigenständige staatsrechtliche Stellung der ehemaligen Gerichtsgemeinden wurde drei Jahre später in der neuen Kantonsverfassung auf die 223 ehemaligen Nachbarschaften übertragen, aus denen nun «mit grosser Autonomie ausgestattete Gemeinwesen mit Staatsqualität» entstanden. 2Aus diesem Grund ist Graubünden bis heute kein «Einheitsstaat», sondern als «Bundesstaat mit Gemeindestaatlichkeit» ein atypisches Mittelding. 3
Allein, die rechtliche Reorganisation der neuen 223 Gemeinden stellte für die Kantonsbehörden, so bringt es Peter Metz auf den Punkt, «ein überaus heikles und umstrittenes Problem» 4dar. Ab Mitte des Jahrhunderts stand der Kanton damit praktisch allein 223 Gemeinden gegenüber. 5Dies war das Spielfeld, auf dem sich der nach Vereinheitlichung strebende Kanton und die Gemeinden mit ihrer überkommenen Vorstellung von Autonomie trafen. 6Was die innere Organisation und rechtliche Ausgestaltung der Gemeinden anging, verhielt sich der Kanton zögerlich: Weder im Gebietseinteilungsgesetz von 1851 noch in der Kantonsverfassung von 1854 wurden entsprechende Artikel aufgenommen. 7Der in Chur erscheinende Liberale Alpenbote kritisierte deshalb 1852, das Gemeindewesen im Kanton Graubünden finde sich «bekanntlich total seinem Schicksal überlassen. Ob und welche Gemeindeordnungen bestehen, ob Gemeinderäthe oder bloss sog. Vorstände bestehen, ob und wie Rechnung abgelegt werde, ob das Gemeindevermögen gut oder schlecht verwaltet werde: um das Alles kümmert sich der Staat so zu sagen gar nichts [sic!]». 8
Читать дальше