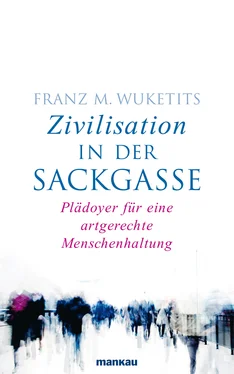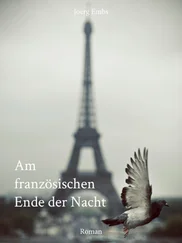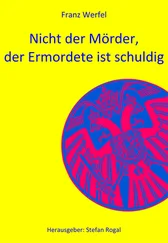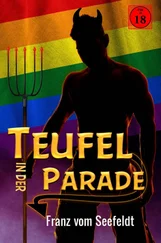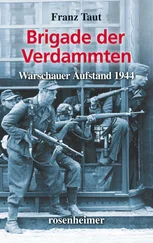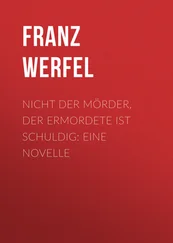Selbstverständlich kann die Zahl jener Menschen, denen wir flüchtig begegnen, mit denen wir aus beruflichen Gründen korrespondieren und so weiter hundertfünfzig oder zweihundert bei Weitem übersteigen. Das ist heutzutage, in urbanen Gesellschaften, auch häufig der Fall. Meine ausgedehnte Vorlesungs- und Vortragstätigkeit bringt mich mit unzähligen Menschen zusammen, doch in der Regel bleibt es bei kurzen und einmaligen Begegnungen, einer Plauderei beim Abendessen nach einer Vortragsveranstaltung oder in einer Hotelbar. Ich erinnere mich dabei an viele mir sympathische Menschen und würde mich über eine Wiederbegegnung freuen, aber es ist nun einmal nicht möglich, mit Tausenden Personen langfristig Bande der Sympathie zu unterhalten. Das ist freilich nicht zuletzt auch eine Frage der geografischen Nähe oder Ferne. Es ist eines, mit Leuten über Distanz zu korrespondieren , ein anderes, persönliche Kontakte zu pflegen . Wer meint, er habe Tausende Freunde in einem sozialen Netzwerk wie Facebook, verwendet nicht nur den Ausdruck „Freund“ inflationär, sondern verwechselt Virtualität mit Realität (wobei gerade diese Verwechslung erst den lockeren Gebrauch jenes Ausdrucks erlaubt).
Grundsätzlich gilt, dass die Intensität sozialer Interaktion mit zunehmender Zahl der interagierenden Personen abnimmt. Dieser in den Sozialwissenschaften und in der Psychologie (aus der Gruppendynamik) bekannte Umstand ist heute evolutionsbiologisch gut begründet. Er ergibt sich eben daraus, dass Menschen die längste Zeit ihrer Evolution mit stets wenigen ihnen vertrauten Menschen gelebt haben. Wenn die Mitgliederzahl einer beliebigen Gruppierung über eine bestimmte Größenordnung hinauswächst, dann sind die Beteiligten nicht mehr imstande, einen vertrauten, intimen Charakter sozialer Beziehungen miteinander zu pflegen. Sie wenden sich voneinander ab oder bilden innerhalb der größer werdenden Gruppe kleinere Gruppen von Individuen, die sich durch gegenseitige Sympathie, gemeinsame Interessen und so weiter auszeichnen und sich mithin gegenseitig anziehen. (Veranstalter großer Festmahlzeiten sind daher stets gut beraten zu überlegen, wer an der Festtafel neben wem sitzen soll.) Selbstverständlich knüpfen wir in Großstädten so manche flüchtige Bekanntschaft, treffen auf dem Weg zum Arbeitsplatz, auf Lebensmittelmärkten und so weiter immer wieder auf dieselben Leute, was aber nicht heißt, dass wir mit diesen Personen in engerem sozialen Kontakt stehen. Wir grüßen sie freundlich, wechseln vielleicht ein paar Worte mit ihnen und gehen dann unserer Wege. Aber kaum einen von ihnen werden wir spontan zu uns nach Hause zum Essen einladen. (Private Einladungen zum Essen haben schon einen recht intimen Charakter und bleiben daher in der Regel wiederum einer nur kleinen Gruppe von Personen vorbehalten.)
ICH UND DER REST DER WELT
Menschen sind, wie alle Tiere, Egoisten. Im strikt soziobiologischen Sinn bedeutet Egoismus jedes Verhalten, das die reproduktive Eignung, also den Fortpflanzungserfolg auf Kosten anderer erhöht. Voraussetzung für die erfolgreiche Reproduktion ist, klarerweise, das Erreichen des fortpflanzungsfähigen Alters. Um aber zumindest bis dahin am Leben zu bleiben, benötigt jedes Lebewesen Ressourcen: Raum und Nahrung. Damit sind Wettbewerb und Konflikte programmiert. Da die Natur kein Schlaraffenland ist und Ressourcen oft knapp sind, versuchen Tiere auf unterschiedlichste Weise, ihre Artgenossen auszutricksen, sie zu „belügen“ und zu „betrügen“. Der Mensch ist dabei keine Ausnahme. Allerdings zwingen ihn soziale beziehungsweise kulturelle Normen, die er sich selbst verordnet hat, dazu, auf andere Rücksicht zu nehmen und sie sogar zu unterstützen. Aber auch diese Normen haben einen tiefen biologischen Unterbau.
Schon einfache und oberflächliche Beobachtungen verdeutlichen, dass in der Tierwelt neben egoistischem auch kooperatives und altruistisches Verhalten vorkommt. Altruismus bedeutet, wieder im strengen Sinn der Soziobiologie, die Erhöhung des Fortpflanzungserfolgs anderer auf eigene Kosten. Wie passt das nun mit der Allgegenwart des Egoismus zusammen? Wie konnte sich in einer vom Egoismus beherrschten Welt uneigennütziges Verhalten entwickeln? Die Antwort ist einfach: weil sich solches Verhalten für den Einzelnen durchaus auszahlt. Das Individuum genießt in seiner Gruppe bestimmte Vorteile. Um sich diese aber dauerhaft zu sichern, ist es gezwungen, mit anderen zu kooperieren, die Hilfe, die es von anderen empfängt, bei Gelegenheit auch zurückzuzahlen. In tierischen Gesellschaften regeln sich diese Dinge ganz von selbst, ohne dass bestimmte „Gruppennormen“ vorgegeben wären. Wölfe etwa jagen im Rudel und arbeiten sozusagen zusammen, weil das jedem von ihnen mit höherer Wahrscheinlichkeit Nahrung sichert als die Jagd im Alleingang. Die Jagdgesellschaften prähistorischer Menschen kann man sich analog dazu vorstellen.
Aber auch die heutigen kleinen Menschengruppen sind gewissermaßen mit Jagdgesellschaften vergleichbar. Sie werden durch ein Band von Sympathie und gemeinsamen Interessen zusammengehalten, auch wenn sie nicht miteinander auf Beutefang gehen. Und manchmal bilden sie tatsächlich noch Jagdgesellschaften im buchstäblichen Wortsinn, die wiederum auch dem Knüpfen sozialer Bande dienen können. Auf den (ganzen) Rest der Welt zu pfeifen, kann sich ohnehin kaum jemand leisten, wenn er nicht in völliger Vereinsamung enden will. Aber wer will das schon!
Freilich ist heutzutage, in unserer Ellbogengesellschaft, ein Phänomen nicht zu übersehen, das im Gegensatz zum „gesunden“ als „pathologischer“ Egoismus bezeichnet werden kann. Der gesunde Egoist ist ein guter Sozialingenieur. Er weiß, dass er andere für die Realisierung seiner eigenen Vorhaben braucht, ab und an von anderen Hilfe in Anspruch nehmen muss, und ist daher im Allgemeinen seinerseits zuvorkommend und hilfsbereit. Er weiß, dass sich Freundlichkeit auszahlt, und folgt dem uralten Prinzip des Nehmens und Gebens. Zwar ist er mit sich selbst zufrieden, schöpft aber diese Zufriedenheit auch aus dem freundlichen und freundschaftlichen Umgang mit anderen. Insgesamt ein netter Kerl also, der aber durchaus seine persönlichen Ziele im Auge behält. Dem pathologischen Egoisten hingegen fehlt jedes Gespür für die Bedürfnisse der anderen, er glaubt, niemanden zu brauchen und daher auch niemandem seine Hilfe anbieten zu müssen. Nichts kennzeichnet den pathologischen Egoismus besser als der dumme Werbeslogan „Geiz ist geil“. Er spiegelt die Einstellung einer Gesellschaft wider, welche dabei ist, ihre eigenen Grundlagen zu zerstören.
Der Mensch ist also von Natur aus egoistisch; doch als vergesellschaftetes Lebewesen auch mit der Anlage zur Kooperation und gegenseitigen Hilfe ausgestattet. Wo diese Anlage nicht gefördert, sondern zerstört wird, dort läuft er Gefahr, altbewährte Mechanismen seiner sozialen Evolution auszuschalten und sich in eine Situation hineinzumanövrieren, die mittel- bis langfristig weder das Überleben des Individuums noch den Fortbestand von Sozietäten sichern kann (und seiner Art nicht gerecht wird). Unsere steinzeitlichen Vorfahren waren keine Engel, aber sie wussten „instinktiv“ um die Bedeutung von Gemeinschaft.
WIR UND DER REST DER WELT
Menschen waren also von Anfang an gut beraten, mit anderen zu kooperieren, einander zu helfen. Schon Friedrich Schiller (1759 bis 1805) sah – noch ohne jeden evolutionstheoretischen Hintergrund – die Sache erstaunlich klar:
Hunger und Blöße haben den Menschen zuerst zum Jäger, Fischer, Viehhirten, Ackermann und Baumeister gemacht. Wollust stiftete Familien, und Wehrlosigkeit der Einzelnen zog Horden zusammen. Hier schon die ersten Wurzeln geselliger Pflichten.
(Schiller 1885, S. 21)
Aber wie bereits betont wurde, haben sich alle Grundmuster unseres sozialen Verhaltens in Kleingruppen entwickelt. So funktionierte auch das Prinzip der Gegenseitigkeit zunächst nur in kleinen und gut überschaubaren sozialen Verbänden. Je fester die Angehörigen eines solchen Verbandes aneinandergekittet waren, desto besser konnten sie sich gegenüber anderen, mit ihnen konkurrierenden Gruppen behaupten. So entstand das Wir-Gefühl , das Gefühl der Gruppenidentität , das sowohl für das Individuum als auch für seine Gruppe von elementarer Bedeutung war – und bis heute geblieben ist.
Читать дальше