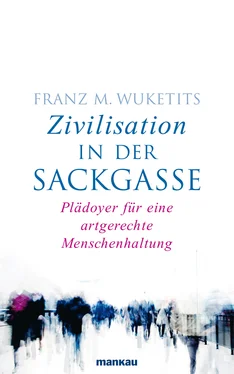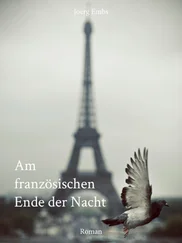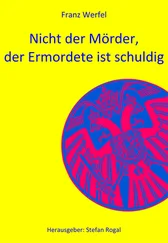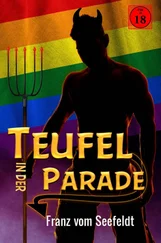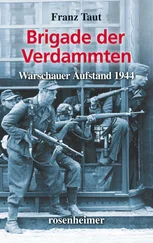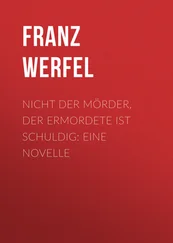Die Gattung Homo , zu der auch unsere eigene Spezies zählt, trat vor etwa zwei Millionen Jahren in Erscheinung und sollte sich gleichsam als Erfolgsmodell in der Evolutionsgeschichte des Menschen herausstellen. Ihre ältesten Vertreter sind Homo habilis und Homo ergaster , etwas jünger – seit etwa einer Million Jahren nachgewiesen – ist Homo erectus , dessen späte „Ausläufer“ noch vor zweihunderttausend Jahren existiert haben dürften. Ursprünglich beschränkte sich auch das Verbreitungsgebiet der Gattung Homo auf Afrika, Homo erectus aber, dessen Erforschungsgeschichte im späten 19. Jahrhundert mit der Entdeckung von Skelettresten auf Java begann, lebte auch schon in Asien und in Europa. Zu einiger Berühmtheit brachte es dabei der sogenannte Peking-Mensch, der in den 1920er Jahren in der Nähe der chinesischen Hauptstadt entdeckt wurde, vor knapp fünfhunderttausend Jahren erstmals in Erscheinung trat und sich bereits im Gebrauch des Feuers übte. Für die paläoanthropologischen Forschung nicht minder bedeutsam ist auch ein „Europäer“, der Heidelberg-Mensch oder Homo heidelbergensis , der vor etwa sechshunderttausend Jahren in Afrika aufgetaucht war und sich später auf unserem Kontinent niederließ. Unsere eigene Art schließlich, Homo sapiens , erschien vor etwa hundertfünfzigtausend Jahren auf der Bühne, und zwar wiederum zunächst in Afrika, von wo aus er nach Europa – und später auf alle anderen Kontinente – auswanderte.
Somit lässt sich heute nicht nur sagen, dass die Wiege der Menschheit in Afrika stand, sondern auch, dass von dort aus immer wieder menschliche Populationen in andere Regionen der Erde eingewandert sind. Diese im Fachjargon als Out-of-Africa bezeichnete Migrationshypothese findet nicht nur in Fossilien und Werkzeugen, sondern auch in molekularbiologischen Untersuchungen (DNA-Vergleichen heutiger menschlicher Populationen) eine veritable Stütze. Was aber hat Menschen immer wieder dazu bewogen, den afrikanischen Kontinent und ihr jeweils angestammtes Territorium zu verlassen? Eine abermals sehr spannende Frage. Es mögen Nahrungsmangel, klimatische Veränderungen und noch andere Faktoren dafür maßgeblich gewesen sein. Vielleicht auch veranlasste seine zunehmende Intelligenz und mit dieser seine sich beständig steigernde Neugier und Entdeckungslust den Menschen schon früh dazu, nach neuen Ufern vorzustoßen, auf neuem Terrain Fuß zu fassen.
Obwohl hier ein nur überaus knapper Abriss der Evolution und Verbreitungsgeschichte des Menschen bezweckt sein kann, darf die Erwähnung des Neandertalers nicht fehlen. Der Homo neandertalensis ist eine Schlüsselfigur der Paläoanthropologie, die als Wissenschaft vom fossilen Menschen mit seiner Entdeckung überhaupt erst ihren Anfang nahm (1856 in einer Höhle im Neandertal bei Düsseldorf). Wenngleich die Existenz des Neandertalers mittlerweile durch zahlreiche Funde aus Europa und dem Vorderen Orient sehr gut dokumentiert ist und seine Lebensweise anhand einschlägiger Grabungsergebnisse gut rekonstruiert werden konnte (nachweislich bestattete er seine Toten und schmückte ihre Gräber mit Blumen), gibt diese „Menschenform“ nach wie vor einige Rätsel auf. Insbesondere ihr Verschwinden vor knapp dreißigtausend Jahren liefert immer noch Stoff für einige Spekulationen. Tatsache ist, dass der Neandertaler zeitgleich mit dem heutigen Menschen, Homo sapiens , lebte, genau gesagt mit dem (nach seinem französischen Fundort benannten) Cro-Magnon-Menschen. Dieser repräsentierte bereits unseren heutigen „Menschentyp“ oder unterschied sich jedenfalls von diesem kaum. (In der heutigen Welt hätte ein Cro-Magnon-Kind alle Voraussetzungen für einen Physikprofessor, einen Lokomotivführer oder einen Bankräuber.) Möglicherweise konkurrierte der Cro-Magnon-Mensch mit dem Neandertaler um Nahrung und ging aus dieser Konkurrenz schließlich als Sieger hervor. Vielleicht auch hat er seinen „Vetter“ – eben als Konkurrenten – ausgerottet. (Völkermorde begleiten ja auch unsere weitere Geschichte.) Vielleicht aber haben sich Neandertaler und Cro-Magnon-Menschen miteinander vermischt, sodass in uns allen heute noch Neandertalerblut fließt …
Wie man sieht, geben uns die eigene Herkunft und unsere Evolutionsgeschichte noch einige Aufgaben auf, die zu bewältigen vielleicht viele Jahre oder Jahrzehnte dauern wird. Aber fest steht, dass Menschen aus „affenartigen“ Vorfahren hervorgegangen sind, der heutige Mensch das Resultat eines mehrere Jahrmillionen umfassenden komplexen Prozesses darstellt und dass er die Zeugnisse seiner Vergangenheit unauslöschlich mit sich herumträgt. Nicht zu zweifeln ist auch daran, dass Menschen während der längsten Zeit ihrer Evolution als Nomaden oder Halbnomaden herumgezogen sind. Jagend und sammelnd waren sie den Unbilden der Natur meist hilflos ausgeliefert und fanden sich in keiner besseren (oder schlechteren) Situation wieder als alle übrigen Tiere auch. Dann aber, vor erst etwa fünfzehntausend Jahren – welch unbedeutender Zeitraum auf der Zeitskala der Evolution! –, geschah etwas recht Eigenartiges: Menschen wurden sesshaft, begannen Siedlungen zu bauen, Pflanzen und Tiere zu züchten (anstatt sie als Wildformen zu sammeln beziehungsweise zu pflücken und zu jagen) und komplexe, arbeitsteilige Gesellschaften zu entwickeln. Es erfolgte der als neolithische oder jungsteinzeitliche Revolution bezeichnete Übergang von der aneignenden zur produzierenden Lebensweise, und zwar zunächst im Vorderen Orient, um aber später auch auf andere Regionen der Erde überzugreifen.
VORTEILE DER SESSHAFTIGKEIT
Selbstverständlich erfolgte dieser Übergang nicht aus heiterem Himmel, von heute auf morgen. Jede Revolution hat ihre – teils lange – Vorgeschichte. Verglichen mit dem langen Zeitraum, in dem Menschen als Jäger und Sammler lebten, erfolgte der Prozess der Sesshaftigkeit allerdings doch recht schnell. Warum aber wurden Menschen dauerhaft sesshaft? Warum begannen sie Ackerbau und Viehzucht zu betreiben? Anfangs muss das eine sehr mühevolle Angelegenheit gewesen sein, Ernteerträge und Erträge aus der Viehzucht waren zunächst einmal wohl ziemlich mager. Seine Nutztiere werden immer wieder auch Raubtieren willkommene Beute gewesen sein (schließlich waren auch Bauern in historischer Zeit noch häufig mit „Raubzeug“ konfrontiert). Die Sesshaftigkeit muss dem Menschen zunächst mehr Nach- als Vorteile gebracht haben. Zur Frage, warum sich denn Menschen nach so langer Zeit des Herumwanderns an einzelnen Orten dauerhaft niederzulassen begannen, wurden schon verschiedene Theorien entwickelt.
Nun leuchtet es durchaus ein, dass Lebewesen, welcher Art auch immer, an einem Platz verweilen, an dem sie üppige Nahrungsressourcen vorfinden. Wenn sich in unseren Breiten im Winter irgendwo Vögel scharen, dann dürfen wir stillschweigend annehmen, dass das vorgefundene Futter ihnen einen Anreiz für ihre Ansammlung bietet. Wildschweine drängen heute immer wieder in Vororte von Großstädten beziehungsweise Stadtaußenbezirke vor, weil sie sich dort an Gartenfrüchten und Abfällen gütlich tun können. Zum Ärger von Haus- und Gartenbesitzern fallen sie über Mülleimer, Komposthaufen und Gemüsebeete her. Warum sollten sie es sich bei der Nahrungsbeschaffung schwer machen, wenn es auch einfach geht?! Hat aber der Mensch, als er sich ursprünglich an bestimmten Orten niederließ, dort auch üppige Nahrung vorgefunden, die ihn zum ständigen Verweilen einlud?
Man nimmt oft an, dass der durch klimatische Veränderungen verursachte Mangel an Jagdwild während der letzten Eiszeit den Menschen dazu gezwungen habe, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Der Mensch entdeckte Wildpflanzen, auf die Vogelschwärme ihn aufmerksam machten, als sie zur Reifezeit einfielen. Den Ernährungswert dieser Pflanzen lernte der Mensch bald zu schätzen und begann sie als Getreide zu domestizieren. Er lernte Techniken, das Getreide zu bewahren und ganzjährig zu nutzen. Dies aber hatte zur Voraussetzung, dass er an Ort und Stelle blieb, Siedlungen – wenngleich zunächst in einfachster Form – errichtete. Da aber auch andere Tiere, vor allem Rinder, Ziegen und Schafe, das Getreide als Nahrungsquelle schätzen, kamen sie ihm als „Ernteräuber“ in die Quere. Dasselbe gilt auch für Schweine, die zwar nicht unbedingt Gerste oder Weizen fressen, sich aber, wie gesagt, an vom Menschen produzierten Abfällen delektieren. Nun wäre es, so kann man weiter argumentieren, für den Menschen auf Dauer zu mühsam gewesen, sich alle diese Tiere vom Leib zu halten, um seine Nutzpflanzen zu schützen. Besser war es, die Tiere sozusagen ins Haus zu holen und sie ebenfalls zu nutzen. Welch enorme Bedeutung die genannten Tiere – heutzutage vor allem Rinder und Schweine – als Nahrungslieferanten im Lauf der Zeit erlangt haben, bedarf keiner besonderen Erwähnung.
Читать дальше