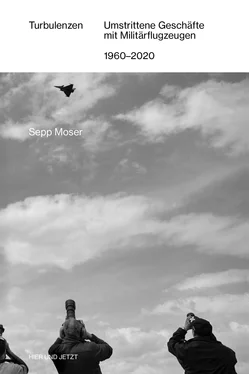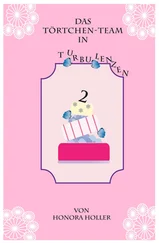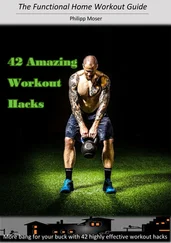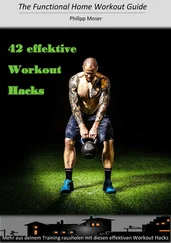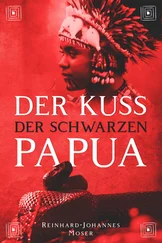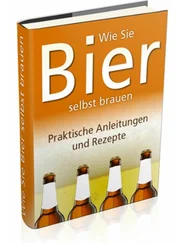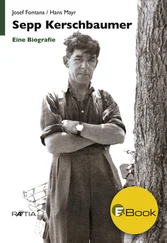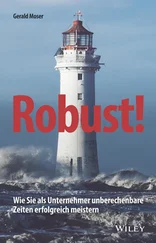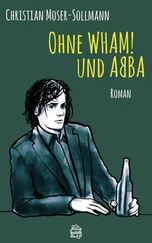Die Konstruktion des F-5 geht auf die Zeit um Mitte der 1950er-Jahre zurück. Das war die Epoche, in der die USA und die damalige Sowjetunion den «kalten Krieg» ausfochten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wetteiferten beide Grossmächte um die Gunst und die Unterstützung zahlreicher junger Staaten (viele von ihnen ehemalige Kolonien europäischer Mächte), die in der neuen Weltordnung einen sicheren Platz zu ergattern suchten. Teil dieses Bemühens war der Aufbau einer eigenen Armee – weniger um sich zu verteidigen als um in der eigenen Bevölkerung den Ruhm ihrer Herrscher zu mehren, aufständische Volksgruppen in die Schranken zu weisen und einmal pro Jahr mit einer bombastischen Militärparade den Nationalfeiertag zu begehen. Zu diesem wiederum gehörten – und gehören manchenorts bis heute – schöne Paradeuniformen für die Soldaten und eine Luftwaffe, deren Kampfflugzeuge mit viel Lärm und mit Rauchspuren in den Farben der nationalen Flagge kunstvolle Figuren in den Himmel zeichnen.
Dazu, und nicht primär zur Verteidigung des Landes gegen einen äusseren Feind, brauchte es geeignete Flugzeuge. Sowohl die Sowjetunion wie auch die USA lieferten gerne und kostenlos ausgediente Jäger aus dem Koreakrieg, aber diese waren in der Regel nicht mehr lange zu gebrauchen und zudem alles andere als «sexy». In dieser kritischen Lage der Weltpolitik sah die US-Flugzeugherstellerin Northrop (heute Northrop Grumman) eine Chance. Unter der Bezeichnung N-156 entwickelte das Unternehmen auf eigene Kosten ein leichtes, einfaches und wartungsfreundliches Düsenflugzeug, dessen einziger Zweck es sein sollte, das Selbstbewusstsein amerikanischer Klientelstaaten (beziehungsweise von deren Herrschern) aufzupäppeln, ohne gleichzeitig das in der betroffenen Gegend der Welt existierende militärische Kräfteverhältnis zu stören und die Sowjetunion ihrerseits zu einer Aufrüstung zu veranlassen. Das Flugzeug sollte also wie ein ernsthaftes Kampfflugzeug aussehen, aber, wie es im amerikanischen Polit-Jargon ganz unverblümt hiess, «nonprovocative» sein, zu Deutsch: harmlos.
Nach anfänglichem Zögern erwärmte sich die US-Regierung für die Idee. Northrop peppte das Flugzeug technisch auf, und die USA lieferten es ab 1962 im Rahmen zahlreicher Militärhilfeprogramme unter der Bezeichnung F-5A in die halbe Welt, ab 1973 auch in der verstärkten und leicht modernisierten Version F-5E. Im eigenen Land wird der Typ, da militärisch annähernd wertlos, in einer vereinfachten und zweisitzigen Version namens T-38 als Schulflugzeug verwendet, ebenso in zahlreichen weiteren Ländern.
Hawk als Basis für den Neubeginn
Mit der als Notlösung beschafften Tiger-Flotte war der erste Schritt zum Aufbau einer glaubwürdigen Luftverteidigung getan. Was noch fehlte, war ein Schulflugzeug auf einem vergleichbaren Stand der Technik. Schliesslich sollten die jungen Piloten von Anfang an so ausgebildet werden, dass sie in der Zukunft auch mit wirklich zeitgemässen Kampfflugzeugen umgehen konnten. Die damals als Standard verwendeten zweisitzigen Vampire-Trainer verkörperten den technischen Stand von 1950 und waren dafür in keiner Weise mehr geeignet.
In aller Stille startete der Bund anno 1984 ein Evaluationsverfahren, welches mit vier Kandidaten begann und nach wenigen Monaten auf zwei Typen konzentriert wurde: auf den französischen Alpha Jet und den britischen Hawk. Ein kurzes Auswahlverfahren mit weniger als 40 Flügen pro Kandidat genügte, um die Entscheidung zugunsten des Hawk zu fällen. In der Folge beschaffte die Schweiz 20 Stück dieses Zweisitzers (mitsamt einem modernen Flugsimulator), welche ab 1990 mit grossem Erfolg eingesetzt wurden. Dies freilich – und entgegen der ursprünglichen Planung – nur bis zum Jahr 2002. Das war das Jahr, in dem die Pilatus Flugzeugwerke erfolglos einen Erstkunden für ihr neues Schulflugzeug PC-21 suchten. Sofort sprang die Schweizer Luftwaffe ein, deponierte die mit zehn Jahren noch absolut tauglichen Hawks in der leerstehenden Felskaverne eines Walliser Militärflugplatzes und kaufte das Schweizer System, welches sich in der Folge bewährte und dank dem Schweizer Sinneswandel zum weltweiten Erfolg wurde.
Acht Jahre später erlöste Finnland die 20 Flugzeuge aus ihrem langen Schlaf, kaufte sie zu einem sehr günstigen Preis, unterzog sie einer Erfrischungskur, integrierte sie erfolgreich in ihre Pilotenschulung und gedenkt, sie noch bis etwa 2030 weiterzuverwenden.
Beinahe gestolpert: F/A-18
Für die Schweiz war die Tiger-Flotte also nie ein glaubhafter Schutzschild (von den in den 1980er-Jahren immer noch verwendeten Hunter-Jets ganz zu schweigen), sondern eher ein Mittel, um die Luftwaffe wenigstens auf dem Niveau eines fortgeschrittenen Drittweltstaates am Leben zu erhalten. Dieses Ziel wurde erreicht. Von Anfang an war jedoch klar, dass dies keine langfristige Lösung sein konnte, zumal die Hunter-Flotte eigentlich in ihrer Gesamtheit längst museumsreif war und die Tiger diesem Zustand Monat für Monat zielstrebig entgegenflogen. 1985 startete der Bundesrat deshalb ein neues Auswahlverfahren mit anfänglich sechs Kandidaten (Rafale aus Frankreich, F-16 und F/A-18 aus den USA, Gripen aus Schweden sowie die in der Folge nicht realisierten Projekte Lavi aus Israel und F-20 aus den USA). Es war im Prinzip das bekannte Prozedere, diesmal jedoch mit dem Unterschied, dass im Lichte früherer Erfahrungen alles unter einem Schutzschild weitgehender Diskretion ablief. Tatsächlich gelang es, den Prozess ohne wesentliche emotionale Streitereien auf sachlicher Ebene voranzutreiben und schliesslich nach rund drei Jahren zu einem aussagekräftigen, wenn auch, wie sich später zeigen sollte, erst provisorischen Ende zu führen. Im Oktober 1988 beantragte der Bundesrat den Kauf von 34 F/A-18 Hornet zum Preis von rund 3 Milliarden Franken.
Damit war zwar die Richtung vorgegeben, das Ziel aber immer noch in weiter Ferne. Jetzt galt es zweimal hintereinander die basisdemokratische Hürde einer Volksinitiative zu überwinden. Das erste Volksbegehren (genannt «für eine Schweiz ohne Armee» und somit logischerweise auch ohne Kampfflugzeuge) wurde am 26. November 1989 abgelehnt, das zweite (dieses spezifisch gegen den inzwischen politisch beschlossenen Kauf der F/A-18) am 6. Juni 1993. Erst jetzt konnten die Verträge rechtsgültig unterzeichnet werden, und seit 1999 ist das Flugzeug bei der Schweizer Luftwaffe vollumfänglich im Einsatz – 16 Jahre nach der Indienststellung durch die Luftwaffe der USA und folglich mit einem technologischen Rückstand von ebenso vielen Jahren. Immerhin verfügt die Schweiz damit erstmals seit langer Zeit über eine zwar kleine, aber im europäischen Umfeld respektierte und technisch einigermassen zeitgemässe Luftwaffe. Doch für wie lange noch?
Bei Niederschrift dieser Zeilen Anfang 2020 haben die 30 verbliebenen Flugzeuge – von ursprünglich 26 Einsitzern und 8 Zweisitzern gingen vier Flugzeuge durch Absturz verloren – im Durchschnitt etwas mehr als die Hälfte ihrer «Lebensspanne» von 6000 Flugstunden hinter sich. Angesichts der langen Zeitdauer für die Bestellung, die Herstellung und die Truppeneinführung eines komplexen Waffensystems liegt es auf der Hand, dass dies der Zeitpunkt ist, ohne erneute Verzögerungen den Schritt in die nächste Generation der Luftkriegführung anzugehen.
Die Gripen-Pleite von 2013/14
Nachdem vorangegangene Beschaffungsprojekte wiederholt im Gegenwind basisdemokratischer Mitbestimmungsansprüche stecken geblieben waren, versuchte es der Bundesrat 14 Jahre nach der erfolgreichen Eingliederung der F/A-18 mit einer neuen Strategie. Er veranlasste eine verwaltungsinterne Evaluation für die nächste absehbare Flugzeuggeneration und legte das Resultat frühzeitig dem Volk zur Genehmigung vor. Es war ein erster Versuch, aus dem geradezu traditionellen Muster aufeinanderfolgender Notfallübungen auszubrechen und den Weg zu einer rationalen, langfristig vorausschauenden Beschaffungsplanung einzuschlagen.
Читать дальше