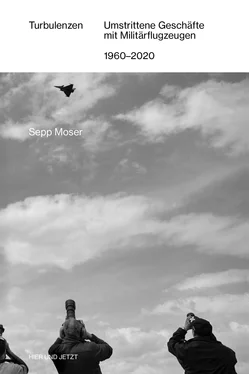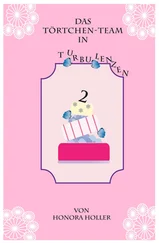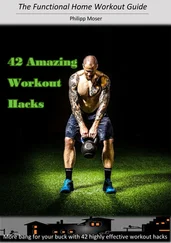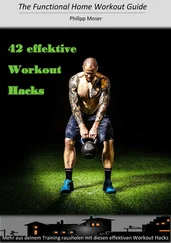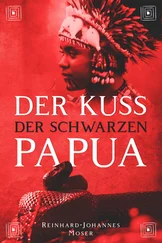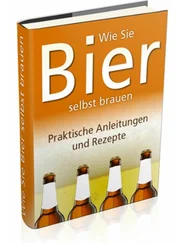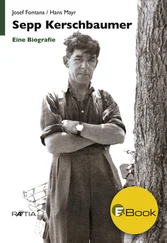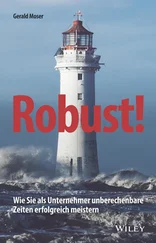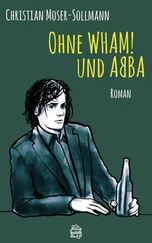Nächster Akt des Trauerspiels: Corsair
Der Mirage-Skandal platzte im Herbst 1964. In der Folge dauerte es ziemlich genau acht Jahre, bis sich das Drama wiederholte – zwar mit anderen Protagonisten, in einem gewandelten weltpolitischen Umfeld und auf einem fortgeschrittenen technischen Niveau, aber nach einem ähnlichen Drehbuch. Diesmal ging es nicht um ein Jagd-, sondern um ein Erdkampfflugzeug, und die Geschichte endete nicht mit einer reduzierten und überteuerten Flotte, sondern mit einem Nullentscheid – ausser Spesen nichts gewesen. Das Reizwort hiess Corsair, unter Technikern «Ling-Temco-Vought (oder kurz LTV) A-7 Corsair II».
Nach der Einführung der Mirage war die Schweizer Luftwaffe bezüglich Raumschutz, das heisst Abwehr angreifender Flugzeuge, und Aufklärung recht gut aufgestellt. Für die Bekämpfung von Erdzielen – Gebäude, Strassen und Brücken, feindliche Panzer, Fahrzeuge und so weiter – fehlten jedoch zeitgemässe Flugzeuge. Neben einigen relativ brauchbaren Hunter-Jets waren in diesem Segment nur veraltete Maschinen der Modelle de Havilland Venom (Baujahre und technischer Stand 1952–1958) und Vampire (1948–1952) vorhanden. Inzwischen hatte sich jedoch die strategische Weltlage verändert, und gemäss der 1966 an die neuen Verhältnisse angepassten Strategie der schweizerischen Landesverteidigung war nun nicht mehr der Luftkampf die primäre Aufgabe der Luftwaffe, sondern die Bekämpfung von Bodenzielen. Es bestand also ein unbestrittener und dringender Bedarf für ein leistungsfähiges Kampfflugzeug dieser Kategorie. Der Corsair II sollte das Problem lösen.
Der Prozess der Typenwahl war komplex und wird hier nur stark gerafft beschrieben. In einer sogenannten Vorevaluation wurden acht Flugzeugtypen summarisch untersucht, unter ihnen auch inexistente Phantasieprodukte wie die AR-7, eine theoretisch angedachte, aber nur als Papierskizze existierende Weiterentwicklung der Ende der 1950er-Jahre gescheiterten schweizerischen Eigenentwicklung P-16. Klarer Sieger in diesem Ende 1969 beendeten Prozess war der A-7E Corsair II. Der französische Typ Milan – eine Art heruntergekochte Mirage – war schon damals eine Option, hatte jedoch keine Chancen. Nach heftigen Interventionen der französischen Regierung kam es zu einer Zusatzevaluation unter Einbezug des eigentlich ausgeschiedenen Milan, die im März 1971 mit einer gut dokumentierten und durch Zahlen belegten Rangfolge endete. Danach stand mit 100 Vergleichspunkten erneut der Corsair an erster Stelle, gefolgt vom ebenfalls amerikanischen A-4S Skyhawk (ein Kampfflugzeug für den Einsatz ab Flugzeugträgern) und dem Milan mit 59 Punkten.
Die Sachlage war klar, doch jetzt begannen die Diskussionen erst richtig heiss zu werden – wohl nicht zuletzt deshalb, weil erneut das politisch unerwünschte, den französischen Wirtschaftsinteressen zuwiderlaufende Modell Corsair die Rangliste anführte. Parallel zu den Diskussionen zogen die Bewerber alle Register, allen voran die Firma Dassault als Herstellerin des Milan. Politiker und Journalisten wurden zu «Informationsreisen» nach Frankreich eingeladen, teuerste Plätze im Live-Programm des Nachtklubs «Moulin Rouge» inbegriffen. Das mag den einen oder anderen Schweizer Gast beeindruckt haben, an den mangelhaften Qualitäten des Milan änderte es ebenso wenig wie am Trommelfeuer der französischen Lobbyisten.
In dieser verfahrenen Situation sah der Bundesrat nur noch einen Ausweg aus dem nicht enden wollenden Hickhack: Eine Flugerprobung der führenden Kandidaten, und zwar gleichzeitig im April und Mai 1972, unter identischen Bedingungen und ohne die Möglichkeit, sich nachträglich mit Argumenten wie «schlechtes Wetter» oder ähnlichen Schutzbehauptungen herausreden zu können. (Nebenbei bemerkt: Vergleichbare Tests im Jahre 2019 fanden gestaffelt und unter verschiedenen Umweltbedingungen statt.)
Die Versuche begannen damit, dass der Corsair pünktlich in der Schweiz eintraf, der Milan jedoch wegen technischer Probleme erst mit drei Wochen Verspätung. In der Halbzeit der Versuchsperiode am 11. Mai 1972 hatte der Corsair 100 Prozent der bis dahin geplanten Flüge absolviert, beim Milan waren 25 Prozent aus technischen Gründen ausgefallen. Weitere Details erübrigen sich – das Bombenschiessen wurde für die Franzosen zum Desaster. Der beste Treffer des Milan aus 1500 Meter Distanz war schlechter als der schlechteste Treffer des Corsair aus 4000 Meter Distanz, oder mit anderen Worten: Der Milan war als Erdkampfflugzeug schlechthin unbrauchbar. Dassault rechtfertigte die peinlichen Resultate später mit der Behauptung, die Bombenziele (mit Tüchern markierte Flösse auf dem Neuenburgersee) seien «mit Anti-Laser-Farbe behandelt» gewesen; so habe das auf Lasertechnik gestützte Feuerleitsystem des Milan sie nicht erkennen können – im Unterschied zum Zielsystem des Corsair, das mit Radartechnik arbeitete.
So klar die Resultate der vergleichenden Flugversuche auch waren, nach dem monate-, ja jahrelangen Trommelfeuer französischer Lockungen und Drohungen war der Kauf eines amerikanischen Kampfflugzeuges keine realistische Option mehr. So fällte der Bundesrat den inzwischen sprichwörtlich gewordenen Nullentscheid: weder Corsair noch Milan, sondern gar nichts und als Lückenbüsser ein paar uralte, militärisch so gut wie unnütze, aber wenigstens politisch unbelastete zusätzliche Hunter.
Hunter: Lieber Oldtimer als gar nichts
Mit dem Nullentscheid des Bundesrates entschwand die angestrebte Sanierung der Schweizer Flugwaffe in weite Ferne. Um den Zusammenbruch der Organisation und den Verlust des im Personal vorhandenen Knowhows zu verhindern, bewilligte das Parlament im März 1973 «aus der Hüfte heraus» und ohne ordentliches Auswahlverfahren 136 Millionen Franken für den Kauf von 30 gebrauchten Hunter-Kampfflugzeugen, für die die britische Royal Air Force keine Verwendung mehr hatte. Das Geschäft ging reibungslos über die Bühne, erstens wegen des relativ geringfügigen finanziellen Umfangs und zweitens, weil die Flugwaffe diesen Flugzeugtyp seit 15 Jahren bestens kannte. Das letzte dieser mittlerweile so gut wie nutzlosen Flugzeuge sollte erst Ende 1994 ausser Dienst gestellt werden, also 36 Jahre nachdem die Schweizer Flugwaffe das erste übernommen hatte. Ironischerweise war es dann auch das Flugzeug Nummer eins, welches «stilecht» als letztes ins Museum flog …
Tiger: Neuanfang mit Misstönen
Mit Museumsstücken lässt sich kein Krieg gewinnen – diese Einsicht liess sich Mitte der 1970er-Jahre nicht mehr verdrängen. Gemäss der anno 1975 einmal mehr erneuerten Verteidigungskonzeption sollte sich die Aufgabe der Schweizer Luftwaffe ab 1980 auf die Unterstützung der Bodentruppen beschränken. Dafür brauchte es definitiv keine schnellen Jäger mehr, sondern robuste, universell verwendbare und vor allem rasch und günstig erhältliche Flugzeuge, mit denen sich zumindest der Eindruck einer schlagkräftigen Luftwaffe erwecken liess. Dazu genügte eine «Proforma-Evaluation», oder wie es ein beteiligter Ingenieur beschreibt: «Eigentlich konnten wir nicht viel mehr tun als die Verkaufsprospekte studieren, ein paar Testflüge machen und dann den Antrag zum Kauf einer Flotte amerikanischer Northrop F-5E Tiger schreiben; eine realistische Alternative gab es nicht.»
Und so kam es: Ende August 1975 bewilligte der Bundesrat 1170 Millionen Franken für den Kauf von 75 Stück, also 15,6 Millionen Franken pro Flugzeug. Im Juni 1981 kam es dann noch zu einer Ergänzungsbestellung über 38 Stück für 770 Millionen Franken, also 20,4 Millionen Franken pro Flugzeug. Opposition oder auch nur eine ernsthafte Diskussion über den Sinn der Sache gab es nicht.
Es war ein hastiger Kauf, getätigt in einer Notsituation und ausschliesslich vom Bestreben geleitet, schnell, günstig und vor allem ohne weitere Skandale etwas auf die Beine zu stellen, was nach einer anständigen Flugwaffe aussah. Kampfkraft spielte keine Rolle: Der F-5E ist nur bei Tag und gutem Wetter einsetzbar, fliegt nur mit Mühe und für kurze Zeit schneller als der Schall und verhält sich zu einem zeitgemässen Kampfflugzeug ungefähr wie ein Smart zu einem Lamborghini. Dies jedoch mit voller Absicht, denn der F-5E wurde von der US-Regierung von Anfang an die Rolle eines «Placebo-Jägers» zugedacht: Das Flugzeug sollte aussehen wie ein Jäger, Lärm machen wie ein Jäger, die Schallmauer durchbrechen können wie ein Jäger – aber kein Jäger sein! Aus der Sicht der USA war dies eine überzeugende Strategie, wenn man sie im Lichte der strategischen Weltlage zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges betrachtet.
Читать дальше