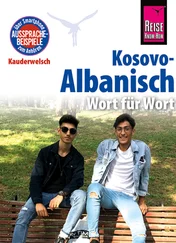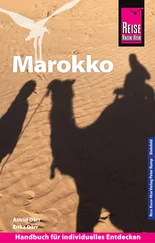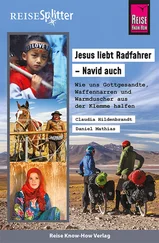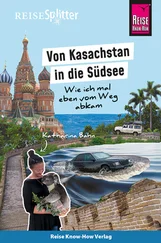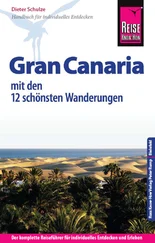Ein lohnender Ausflug lässt sich zum beeindruckenden Sturmflutmuseuman der Oosterschelde machen. Es liegt etwas außerhalb des Dorfes Ouwerkerk.
Das Datum 1. Februar 1953kennt jeder Zeeländer, und fast jeder hat in dieser Nacht jemanden aus seiner Verwandtschaft verloren. Es war der Tag, an dem eine schwere Sturmflut Zeeland und vor allem Schouwen-Duiveland unter Wasser setzte. 49.000 Häuser und Bauernhöfe waren betroffen, in einer einzigen Nacht starben 1836 Menschen.
Omoda: eine zeeländische Erfolgsgeschichte
Wer über die Zeelandbrücke von Noord-Beveland nach Schouwen-Duiveland fährt, sieht linker Hand ein riesiges, flaches Gebäude mit einem runden Logo: Omoda . Mode vielleicht? Ja, mehr noch. Es handelt sich um Schuhmode.Was heute ein gigantisch großes Unternehmen ist, begann einmal ganz klein. Im Jahr 1875 war Herr Verton als Schuster in Burghbekannt, seine Schuhe fuhr er mit der Pferdekutsche zu den Kunden. Auch die nächsten Generationen führten das Schuhbusiness weiter: Im Jahr 1961 eröffnete das erste Schuhgeschäftnamens Verton Schoenen in Zierikzee. Es war derart beliebt, dass weitere Läden in Zeeland, später in den Niederlanden und sogar in der belgischen Modestadt Antwerpen folgten. Heute verkaufen 21 Omoda-Filialensowie ein Internet-Versandhandel Schuhe der Marken Adidas, Geox, Hugo Boss, Katy Perry, Michael Kors und andere.
Wie konnte es zur großen Flutkatastrophekommen?
Stürme kennt man an der Nordsee nur zu gut. Doch meistens legen sie sich nach drei bis vier Stunden wieder. Anders war es an den Tagen vor der Katastrophe am 1. Februar 1953.Es prallten gleich zwei Tiefdruckgebiete aufeinander, der Sturm dauerte rund 32 Stunden an. Die Flutberge konnten sich bei Ebbe nicht mehr abbauen und das Wasser wurde kontinuierlich an die Deiche gedrückt, es schwabbte letztendlich über. Da die Deiche auf der Meeresseite leicht ansteigend, auf Landseite aber steil abfallend sind, konnte das übergelaufene Meerwasser sie auf der Landseite aushöhlen. In Zeeland brachen die Deiche an 400 Stellen,wobei es Schouwen-Duiveland und die südholländische Insel Goeree-Overflakkee am härtesten traf.
Die Folgen der Flut
Die Folgen der Überflutung sind heute noch sichtbar: Auf Schouwen-Duiveland gibt es – außer rund um den Kirchturm in Zierikzee – keinen Baum aus der Zeit vor 1953.Jegliche Vegetation wurde vom Salzwasser zunichte gemacht (im Übrigen auch Tausende Tiere). Der Maidorn, der früher überall blühte, starb aus. Noch heute sieht man an vielen alten Häusern eine weiße Salzschichtaus dem Backstein hervortreten. Das Salz sitzt auf ewig in den Gemäuern fest.
Und natürlich blieb das Grauen in den Köpfen der Menschen verhaftet. Viele von ihnen konnten Jahrzehnte lang nicht über das ihnen Zugestoßene sprechen. Wie kann man es auch verkraften, wenn man Frau und vier Kinder in den Fluten verloren hat – und oftmals dabei auch noch zusehen musste? Auch die Angstbleibt: Zieht ein Sturm übers Land, steigt die Furcht bei den Älteren, die die Flutkatastrophe als Kind miterlebten.
Wie ist die Lage heute?
Diese Angst ist nicht unbegründet, so erfährt man im Watersnoodmuseum.Durch den Klimawandel und den steigenden Meeresspiegel sind die Zeeländer noch immer den Gefahren des Meeres ausgesetzt. Zwar trägt der Deltaplan viel zum Schutz Zeelands vor den Fluten bei, doch mit immer heftigeren Regenfällenstellen auch die Flüsse eine Bedrohung dar. Was geschieht mit einer Gegend, die größtenteils metertief unter dem Meeresspiegelliegt, wenn das Wasser steigt?
Regelmäßig treffen sich Experten, um den Notfall zu diskutieren und eventuelle Evakuierungendurchzuplanen. Anpassungen gibt es bereits: Die Strommasten sind sturmerprobt und führen hoch über dem Boden die Leitungen von einem Ort zum nächsten. Bei den Straßen und Eisenbahngleisen wird untersucht, wie sie einer Überflutung standhalten können. Auch die Sandaufschüttungenvor der Küste tragen zur Sicherheit bei. Dazu wird Sand aus den Tiefen der Nordsee geholt und vor der Küste ins Wasser geblasen (man kann es teilweise vom Strand aus sehen), wodurch sich der Strand verbreitert und eine natürliche Schutzzone bildet.
Das Watersnoodmuseum macht diese Katastrophe greifbar, sichtbar, erlebbar. Mit Original-Filmaufnahmen, gefundenen Gegenständen, Andenken an die Toten, Aufzählung aller Namen, den Geschichten von über 300 Überlebenden und Rekonstruktionen des Wiederaufbaus. Das Museum ist ebenso interessant wie ergreifend. So liegt dort eine alte Armbanduhr, die zum Zeitpunkt der Katastrophe stehenblieb. Sie gehörte einer Frau, die in den Fluten umgekommen ist. Und man sieht die Schultasche eines Jungen. Er wurde zusammen mit seiner Mutter von den Fluten mitgerissen; die Mutter rettete sich, indem sie sich mit Stromkabeln an einem Telefonmast festband. Glück im Unglück: Das Baby Teun Biemond überlebte, weil ihn seine Eltern in Decken wickelten und in einem Korb mitnahmen. So lassen sich die Geschichten fortsetzen …
Untergebracht ist das beeindruckende Museum in sogenannten Caissons , also Senkkästen. Mit diesen Caissons wurde das Loch im Deich von Ouwerkerk geschlossen. Es war die letzte noch offene Deichbruchstelle Zeelands, durch die das Wasser ein Jahr lang bei Flut einfließen konnte. Mit dem Einsetzen der Senkkästen war auch diese Stelle geschlossen und der Wiederaufbau konnte beginnen. Vier 60 Meter lange Betonkästen bieten heute dem Watersnoodmuseum ein eindrucksvolles Unterdach, in das jährlich 90.000 Besucher kommen.
An der Kasse erhält man einen Audioguide in deutscher Sprache. Sehenswert ist auch der 20 Minuten dauernde Dokumentarfilmmit Originalaufnahmen aus dem Jahr 1953 (in niederländischer Sprache mit englischen Untertiteln).

015ze ug
Was die große Flutkatastrophe von 1953 mit sich riss …
 Watersnoodmuseum,Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk, www.watersnoodmuseum.nl/DE, April bis Okt. tägl. 10–17 Uhr, Nov. bis März tägl. außer Mo 10–17 Uhr, Eintritt 12 € Erw., 6,50 € Kinder 5–12 Jahre.
Watersnoodmuseum,Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk, www.watersnoodmuseum.nl/DE, April bis Okt. tägl. 10–17 Uhr, Nov. bis März tägl. außer Mo 10–17 Uhr, Eintritt 12 € Erw., 6,50 € Kinder 5–12 Jahre.
 Anfahrtmit öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Busbahnhof Zierikzee Sasfährt ein Shuttle-Bus zum Museum.
Anfahrtmit öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Busbahnhof Zierikzee Sasfährt ein Shuttle-Bus zum Museum.
 Auf dem Weg von Zierikzee Richtung Serooskerke sind von der N59 aus gleich mehrere Wasser- und Weidegebietezu sehen. Sie entstanden im Rahmen des „Plan Tureluur“. Hintergrund ist, dass durch den Bau des Oosterscheldesturmflutwehrs Ebbe und Flut in der Oosterschelde nicht mehr so ausgeprägt waren und dadurch Sand- und Schlickbänke verschwanden. Um dies zu kompensieren wurden Ackerflächen mit salzigem Boden, ein Überbleibsel der Überschwemmungskatastrophe des Jahres 1953, wieder der Natur zurückgegeben. So entstanden neue Brutgebiete für Weide- und Wasservögel.Unweit des Prunjepolder liegt das älteste dampfbetriebene Pumpwerk Zeelands aus dem Jahr 1876, das heute jedoch nicht mehr in Betrieb ist und als Wohnhaus genutzt wird.
Auf dem Weg von Zierikzee Richtung Serooskerke sind von der N59 aus gleich mehrere Wasser- und Weidegebietezu sehen. Sie entstanden im Rahmen des „Plan Tureluur“. Hintergrund ist, dass durch den Bau des Oosterscheldesturmflutwehrs Ebbe und Flut in der Oosterschelde nicht mehr so ausgeprägt waren und dadurch Sand- und Schlickbänke verschwanden. Um dies zu kompensieren wurden Ackerflächen mit salzigem Boden, ein Überbleibsel der Überschwemmungskatastrophe des Jahres 1953, wieder der Natur zurückgegeben. So entstanden neue Brutgebiete für Weide- und Wasservögel.Unweit des Prunjepolder liegt das älteste dampfbetriebene Pumpwerk Zeelands aus dem Jahr 1876, das heute jedoch nicht mehr in Betrieb ist und als Wohnhaus genutzt wird.
Читать дальше
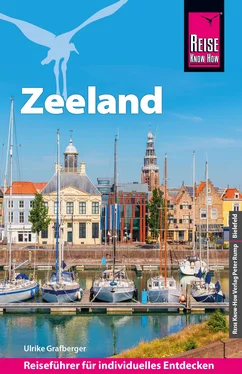

 Watersnoodmuseum,Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk, www.watersnoodmuseum.nl/DE, April bis Okt. tägl. 10–17 Uhr, Nov. bis März tägl. außer Mo 10–17 Uhr, Eintritt 12 € Erw., 6,50 € Kinder 5–12 Jahre.
Watersnoodmuseum,Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk, www.watersnoodmuseum.nl/DE, April bis Okt. tägl. 10–17 Uhr, Nov. bis März tägl. außer Mo 10–17 Uhr, Eintritt 12 € Erw., 6,50 € Kinder 5–12 Jahre. Auf dem Weg von Zierikzee Richtung Serooskerke sind von der N59 aus gleich mehrere Wasser- und Weidegebietezu sehen. Sie entstanden im Rahmen des „Plan Tureluur“. Hintergrund ist, dass durch den Bau des Oosterscheldesturmflutwehrs Ebbe und Flut in der Oosterschelde nicht mehr so ausgeprägt waren und dadurch Sand- und Schlickbänke verschwanden. Um dies zu kompensieren wurden Ackerflächen mit salzigem Boden, ein Überbleibsel der Überschwemmungskatastrophe des Jahres 1953, wieder der Natur zurückgegeben. So entstanden neue Brutgebiete für Weide- und Wasservögel.Unweit des Prunjepolder liegt das älteste dampfbetriebene Pumpwerk Zeelands aus dem Jahr 1876, das heute jedoch nicht mehr in Betrieb ist und als Wohnhaus genutzt wird.
Auf dem Weg von Zierikzee Richtung Serooskerke sind von der N59 aus gleich mehrere Wasser- und Weidegebietezu sehen. Sie entstanden im Rahmen des „Plan Tureluur“. Hintergrund ist, dass durch den Bau des Oosterscheldesturmflutwehrs Ebbe und Flut in der Oosterschelde nicht mehr so ausgeprägt waren und dadurch Sand- und Schlickbänke verschwanden. Um dies zu kompensieren wurden Ackerflächen mit salzigem Boden, ein Überbleibsel der Überschwemmungskatastrophe des Jahres 1953, wieder der Natur zurückgegeben. So entstanden neue Brutgebiete für Weide- und Wasservögel.Unweit des Prunjepolder liegt das älteste dampfbetriebene Pumpwerk Zeelands aus dem Jahr 1876, das heute jedoch nicht mehr in Betrieb ist und als Wohnhaus genutzt wird.