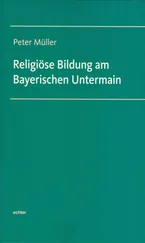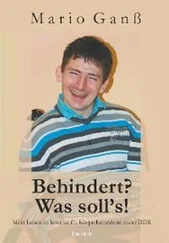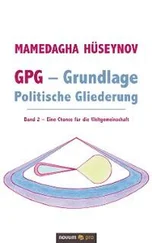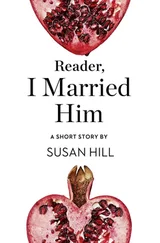2. Position
Der Baustein Positionknüpft an den Kontextan, indem zwei Pole einer politisch-pädagogischen Auseinandersetzung beschrieben werden. Nach einigen allgemeinen Erklärungen zeigt dieser Baustein die Position der Autorin bzw. des Autors in Bezug auf den politisch-pädagogischen Gegensatz. Anschliessend wird der Leser bzw. die Leserin mithilfe des Elements ◽ Multiple Choiceaufgefordert, selbst Position zu beziehen. Auf diese Weise können die Leserinnen und Leser Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der Konzeption der Autorin bzw. des Autors entdecken (vgl. Baustein 3. Lektüre), die eigenen Vorstellungen im Feld der Politischen Bildung verorten und daraus Schlussfolgerungen für die (eigene) Praxis ziehen (vgl. Baustein 4. Kontroverse). Ergänzt wird dieser Baustein um eine biografische Notiz, welche die persönliche Lebenssituation der Autorin bzw. Autors ersichtlich macht.
3. Lektüre
Das Element ▼ Fragen zum Textrichtet die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser auf diejenigen Punkte, die vor dem gesellschaftspolitischen Hintergrund besondere Bedeutung besitzen. Damit soll das Verständnis für die Konzeption der Autorin bzw. des Autors vertieft werden. Dies macht es möglich, die Konzeption auf der Grundlage der eigenen Position zu bewerten. Anschliessend folgt der farbig unterlegte ◗ Quellentextmit einer durchgehenden Zeilennummerierung und Platz für eigene Notizen.
4. Kontroverse
Dieser Baustein verbindet den angesprochenen politisch-pädagogischen Gegensatz, die Position des Autors bzw. der Autorin und diejenige der Leserinnen und Leser mit einer aktuellen Kontroverse im Feld der Politischen Bildung. Der Baustein besteht aus zwei Teilen. Das Element ● Inputvermittelt Einsichten und Erkenntnisse aus der empirischen Forschung und der Theorie der Politischen Bildung oder anderen Feldern der Wissenschaft, insbesondere der Politikwissenschaft und Geschichte. Damit bildet der Input die Grundlage für die ❖ Diskussion, dem zweiten Element. Was unter Diskussionen in der Politischen Bildung verstanden werden kann, wird im nächsten Abschnitt näher beschrieben.
Exkurs: Arten von Diskussionen
Nicht nur der Baustein 4. Kontroverse, sondern auch die Bausteine 2. Positionund 3. Lektürebieten Anregungen für Diskussionen. Bedingung ist natürlich, dass mehrere Personen anwesend sind, die sich über das Thema unterhalten wollen. Das Ziel der Diskussion bestimmt in der Regel die Form des Austausches. Es empfiehlt sich zu klären, welche Art von Diskussion überhaupt geführt werden soll. Parker und Hess (2001) haben für die Ausbildung von Lehrpersonen folgende Arten von Diskussionen beschrieben: Gespräch, Seminar und Deliberation.
| Dimensionen |
Gespräch |
Seminar |
Deliberation |
| Ziel |
Eine Einigung über gemeinsame Ziele erlangen |
Ein besseres Verständnis eines Textes erlangen |
Entscheiden, was zu tun ist, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen |
| Text |
Ziele in Bezug auf ein öffentliches Problem |
Text, Film, Kunstwerk, Ausstellung, Vorstellung, Karikatur, Ereignis, Idee |
Alternativen für ein öffentliches Problem |
| Fokusfrage |
Welche Art Gesellschaft (Klassenzimmer) wollen wir? |
Was will der Autor bzw. die Autorin mit dem Text sagen? |
Was sollen wir tun, um ein Ziel zu erreichen? |
| Beispiel |
Zielsetzung im Klassenzimmer |
Sokratisches Seminar |
Akademische Kontroverse |
Tabelle (aus dem Englischen übersetzt und leicht angepasst): Parker und Hess (2001: 281).
Im Baustein 2. Positionkann beispielsweise ein Gespräch darüber geführt werden, welche politischen und pädagogischen Ziele den Vorstellungen der Leserinnen und Leser entsprechen und wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den diskutierenden Personen vorhanden sind. Im Baustein 3. Lektüregeht es darum, ein besseres Verständnis der Quelle zu erlangen und damit die Position des Autors nachzuvollziehen (Seminar). Falls in einem Gespräch die Verständigung auf ein gemeinsames Ziel gelingt, kann im Baustein 4. Kontroversedie Frage erörtert werden, was zu tun ist, um dieses Ziel zu erreichen (Deliberation). Dadurch können zunehmend Inhalte und Methoden der Politischen Bildung zur Sprache kommen. Deliberation macht dann Sinn, wenn die Gruppe ein gemeinsames Ziel definiert hat oder sich zumindest darüber verständigt hat, worin keine Übereinstimmung besteht. Die Fragen in den Kapiteln beziehen sich auf diese drei Arten von Diskussionen. Personen, welche die Diskussionen leiten, können diese Typologie einsetzen, indem sie auf die zentralen Fragen der Diskussion hinweisen. Wenn das Ziel der Diskussion klar ist, können die Beiträge besser eingeordnet werden. Dadurch sinkt das Risiko, dass der rote Faden in der Diskussion verloren geht.
3.Was steckt hinter den Leitideen des Readers?
Die beiden Leitideen sind zu Beginn der Einleitung bereits erwähnt worden. Erstens wird die Bedeutung des gesellschaftspolitischen Hintergrunds für die historische Konzeption betont. Zweitens soll aufgezeigt werden, inwiefern das aktuelle Feld der Politischen Bildung von den historischen Konzeptionen geprägt wird.
Der gesellschaftspolitische Kontext
Seit der Helvetischen Revolution sind je nach Zeitepoche unterschiedliche Gefahren und Herausforderungen für Gesellschaft und Staat identifiziert und beschrieben worden. Auf der Grundlage dieser Wahrnehmungen sind für die Politische Bildung jeweils andere Ziele formuliert worden. Die nächste Generation soll mit Werten, Wissen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgestattet werden, um das Überleben der eigenen Kultur und des politischen und ökonomischen Systems zu sichern. Andererseits besteht auch der Anspruch, dass (Politische) Bildung das Potenzial der Menschen gegen den Widerstand bestehender Macht- und Herrschaftsverhältnisse zur Entfaltung bringt. Dies wird oft mit der Zielvorstellung der Autonomie ausgedrückt. Weil sich diese Zielvorstellungen widersprechen, spricht Gruntz-Stoll (1999) von pädagogischen Antinomien zwischen Bewahren und Verändern, Bindung und Freiheit. Steht die Freiheit des Individuums im Vordergrund oder soll sich der bzw. die Einzelne möglichst gut an das bestehende System anpassen? Soll das Streben nach Veränderung gefördert werden oder Bestehendes möglichst bewahrt bleiben? Der gesellschaftspolitische Kontext kann erklären, zu welcher Seite der Antinomie die jeweilige historische Konzeption der Politischen Bildung tendiert.
In der Bildungslandschaft gibt es immer gegenläufige Strömungen. Einige Pädagoginnen und Pädagogen betonen die Freiheit des Individuums, andere die Bindung an das vorhandene System. Badertscher und Grunder (1997) sprechen in ihrem Werk «Geschichte der Erziehung und Schule in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert» von sechs pädagogischen «Leitlinien»: 1) Allgemeine Bildung – zweckbestimmte Bildung, 2) Liberalismus – Konservatismus, 3) Pestalozzianer – Herbertianer, 4) Humanistische Bildung – fachwissenschaftliche Bildung, 5) Zentralismus – Föderalismus sowie 6) Mädchen- und Frauenbildung – Jungenbildung. Diese Leitlinien waren jeweils während einer gewissen Zeitspanne in der Geschichte der Erziehung und Schule in der Schweiz besonders intensiv ausgeprägt. Badertscher und Grunder (1997) beschreiben, wie die erwähnten Polaritäten zwischen 1790 und 1945 auftreten. Die Leitlinien behalten jedoch eine gewisse Bedeutung über die jeweilige Zeitspanne hinaus. So werden die Autorinnen und Autoren bzw. deren Konzeptionen noch Jahrzehnte später zitiert. Die Bestimmung der Leitlinien dient also einer Erkundung der «Gegensätzlichkeiten» oder gar der «Kampflinien» pädagogischer Argumentationen.
Читать дальше