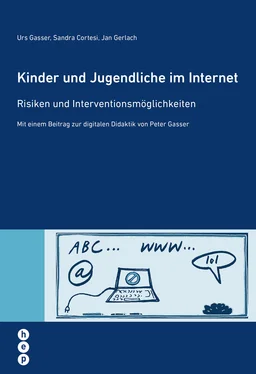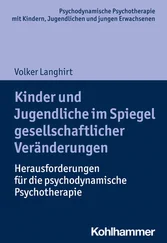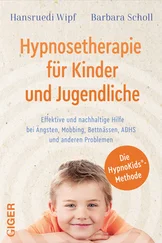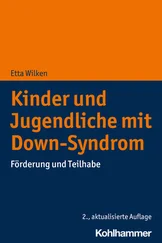(3) Das fallbasierte Lernen ist den meisten Lehrkräften im Zusammenhang mit traditionellem Unterricht bekannt, man kennt in vielen Fachgebieten Fälle, Fallsammlungen und kasuistische Verfahren. Die Effektivität der Lernmethode hängt dabei wesentlich vom Design und von der Aufarbeitung der Fälle ab.
Fälle sind auch in der Internet- und Informatikliteratur beliebte Illustrationsmittel (vgl. dazu die »einführenden Beispiele« im vorliegenden Buch, die jeweils einen Zugang erschliessen und erleichtern). Derzeit fehlen Internetphänomenspezifische Fallsammlungen. Immerhin lassen sich im literarischen und im Internetangebot beispielsweise zum Thema »Facebook« viele Illustrationsfälle finden, deren Detaillierungsgrad allerdings inkonsistent und meist ungenügend ist. 12Etwas dichter ist die Faktenlage bei Negativschilderungen wie Schulamok oder bei Biografien erfolgreicher oder berühmter Leute (Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jimmy Wales, Steve Jobs, Julian Assange usw.). Im Prinzip geht es darum, möglichst aspektreich und hintergrundorientiert einen Fall oder eine Biografie zu entfalten und exemplarisch zu studieren bzw. das Charakteristische und Allgemeine, Prinzipielle herauszuholen. Neben Vorfällen und Biografien lassen sich auch einzelne markante digitale Phänomene und deren Entwicklung kasuistisch bearbeiten, beispielsweise Wikipedia (Begründer – Entstehung – Verbreitung – Nutzung – Schwachstellen – Kommunikationskultur – Vergleich mit Fachlexika usw.) 13(4) Der Ansatz des problemorientierten Lernens lässt sich für viele Themen fruchtbar machen, die in der aktuellen Internetdiskussion und im vorliegenden Buch als »Gefahren« erwähnt, geschildert oder dokumentiert werden – allen voran das Cyberbullying. Dazu gibt es bereits Monografien, die sich durchaus modellartig als problemorientierte Auseinandersetzungen nutzen lassen. 14
Beim problemorientierten Lernen sind neben dem informationellen Wissensanteil (Worum geht es?) auch der motivationale Haltungsanteil (Was will ich bzw. was will ich nicht?) und Ansätze der Therapie (Wer ist für Hilfe zuständig?) zu beachten. 15
Im Zusammenhang mit den im vorliegenden Buch präsentierten Interventions- und Präventionsvorschlägen seien beispielsweise für die Themen Cyberbullying/ Sexting/ Pornografie-Konsum tabellarisch folgende Möglichkeiten in Erinnerung gerufen:
Massnahmenebene Technologie: Identifizierungs- und Altersverifizierungstechnologien, Filterungstechnologien, Standardvereinbarungen
Massnahmenebene Rechtsrahmen: Schutznormen, Verstärkung von Fahndungsverfahren und -personal, Rechtsdurchsetzung, Verbote
Massnahmenebene Elternaufklärung: Elterngespräche mit Jugendlichen, an Eltern adressierte Broschüren/Alltagshilfen/Literatur; Elternabende
Massnahmenebene Schule: Schulinterne Internetberatung, Workshop und Modulangebote (z. B. bezüglich Straf- und Sanktionswirkungen); Internet-Chatroom (z. B. Sicherheitsregeln im Facebook), Schulordnung/Schulreglemente und Verfügungen; Peer-Verantwortung (Gruppengespräche/Klassenmeetings)
Massnahmenebene Peer-Group: Beiträge und kreative Lösungen von Jugendlichen sind zu beachten und zu belohnen; Jugendliche sind in ihrer Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung zu unterstützen
Massnahmenebene Öffentlichkeit: Berichte in Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsendungen, Angebot anonymer Internetberatung und -therapie, Internetangebote zu den erwähnten Gefahren; selbstorganisierte Peer-Aufklärung
(5) Auch das Projektlernen ist Lehrenden aller Schulstufen bekannt und neuerdings im Bereich digitaler Bildungsreformen, schulischer ICT-Integration und Pilotprojekte verbreitet, angefangen mit vereinzeltem Einbau von digitalen Übungs- und Spielformen in den Normalunterricht und in Einzelfächer wie Mathematik, Musik, Erdkunde, Fremdsprachen usw. Über den Einsatz von Handy als Lern- und Arbeitswerkzeug, mit dem Wiki Lerninhalte wiederholen, strukturieren und vernetzen bis zu Versuchen mit »One-to-One-Computing (z. B. Ben Bachmair, Universität Kassel, Werner Hartmann, PH Bern), Einsatz von Notebook und interaktiven Whiteboards an Grundschulen (Henry Heper, Universität Magdeburg), 1:1-Computing mit Netbooks im Primarschulunterricht (z. B. Primarschule Guttannen in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Bildungsinformatik der PH Bern), bis zum professionellen Lernen und Arbeiten mit Netbooks im Unterricht an der Kantonsschule Sursee. 16Zu den Pilotversuchen und praktischen Erfahrungen liegen mehrere Praxisberichte verschiedener Stufen vor. 17
Abgesehen von den Endgeräten und deren schulischem Einsatz lassen sich auch zentrale Themen der Digitalisierung projektartig bearbeiten. Dabei können beispielsweise Monografien zum Thema »Facebook« alle relevanten Aspekte i. S. eines inhaltlichen Handlaufs für Teilthemen wie die folgenden liefern: Facebook-Zugang – Selbstdarstellung – Reputation – digitale Identität – privater oder öffentlicher Raum – Schutz der Privatsphäre – digitales Dossier – Facebook als Falle – Spurenbeseitigung – Cybermobbing im Facebook – freie Meinungsäusserung – Like-Button – Datenschutzskandale – Facebook im Netz der Interessen. 18
(6) Systeme und systematischer Unterricht haben bislang die europäische Bildung dominiert. Wegleitend sind weitgehend auch heute noch die zu Lehrbüchern geronnenen Fachsystematiken der Biologie, Physik, Mathematik, Geschichte usw., die man nach Laienauffassung am besten auswendig lernt. Immerhin scheint manchenorts dieser Bildungstopos im Schwinden begriffen: Das internetdominierte Suchen, Finden, P2P-Bearbeiten, Verwerten, Gestalten und Austauschen ersetzt das öde Dozieren und das kopf- und memorierlastige Lernen. Andererseits breiten sich digital konfigurierte Bildungsangebote und Szenarien aus, die die modernen Fachcurricula (insbesondere an Hochschulen und Universitäten) mit E-Learning, Blended Learning, Lernplattformen, Mobile Learning, Micro-Learning, Online-Moderation, Tele-Tutoring und Aktivitäten im virtuellen Klassenzimmer durchdringen. Meistens sind entsprechende Lehr-Lern-Angebote an spezifische Institutionen (und deren Informatikbeauftragte bzw. Protagonisten) gebunden. 19
Zusammengefasst: Viele junge Menschen mit Internetzugang haben heute eine weitreichende und beeindruckende Medienkompetenz, die sie mit selbstorganisiertem, informellem Lernen erworben, ausgetauscht und im Sinne des Web 2.0 eingesetzt haben. Sie holen sich die gewünschten Informationen aus dem Netz, sie nutzen mit ihren Geräten Internet und soziale Netzwerke wie Facebook usw., tauschen Informationen aus, bauen eine digitale Identität auf, nutzen Open-Source-Lernplattformen, übermitteln und teilen Nachrichten, Texte und Bilder, nutzen Film-, Musik- und Spielangebote – oft auch ausserhalb des wünschenswerten Rahmens. Die Schule kann und muss diese Ressourcen nutzen und einbeziehen 20sowie zur Kenntnis nehmen, dass das mit mobilen Endgeräten nutzbare Internet- und Digitalangebot in lerntheoretischer Sicht der bislang exzellenteste und konsequenteste Beitrag zum individualisierenden formellen und informellen Lernen ist. Die Schule muss aber auch den entsprechenden Gefahren gegensteuern und mithin jene jungen Nutzerinnen und Nutzer fördern, deren Teilnahmechancen (im Rahmen des sich manchenorts eröffnenden sogenannten »participation gap«) geringer ausgefallen sind. Wenn die Chancen genutzt werden sollen, ist im geschilderten Sinne teilweise ein Paradigmenwechsel der Lehr- und Lern-Formen nötig. Zudem sind auf verschiedenen Ebenen entsprechende Informatikangebote – inklusiv angemessene Zeitgefässe für den Unterricht – zu machen, finanziell und personell differenziert zu unterstützen sowie die lehrspezifischen Medienkompetenzen der Lehrenden auf- und auszubauen. Die besondere informationelle Qualität der Beiträge von Lehrpersonen liegt meines Ermessens nicht nur im Beschaffen, Einrichten und Betreiben technologischer Geräte, in deren Handhabung und digitale Nutzung im Sinne von ICT, sondern in der weiterführenden und vertiefenden, hintergrundkundigen Aufklärung unter Einschluss nicht nur der jungen Menschen, sondern auch der Erziehungsverantwortlichen (inkl. Eltern), die sich gegen Internetmythen richtet und dem journalistischen und eindimensionalen Feldzug gegen Informatik und Internet entgegenstellt. Dies soll abschliessend an drei brisanten und aktuellen Themen erläutert werden.
Читать дальше