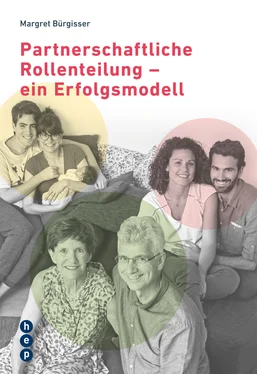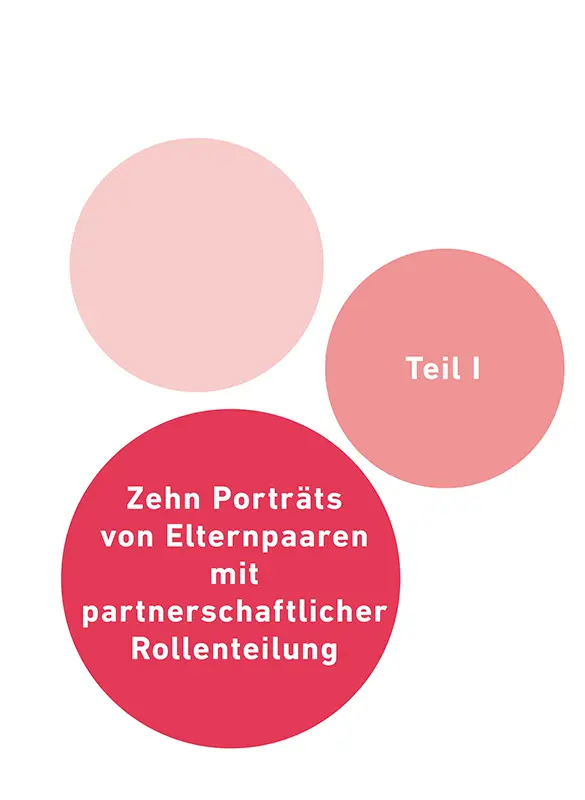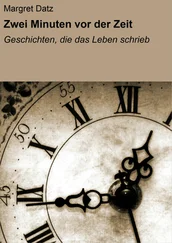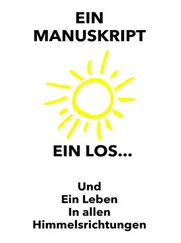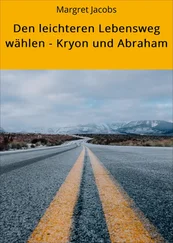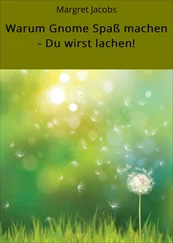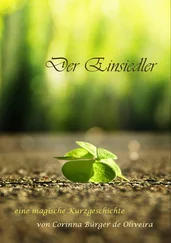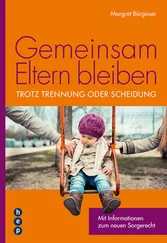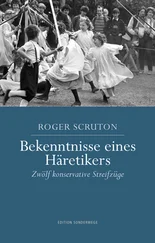Luzern, April 2017
Margret Bürgisser
TEIL I ZEHN PORTRÄTS VON ELTERNPAAREN MIT PARTNERSCHAFTLICHER ROLLENTEILUNG
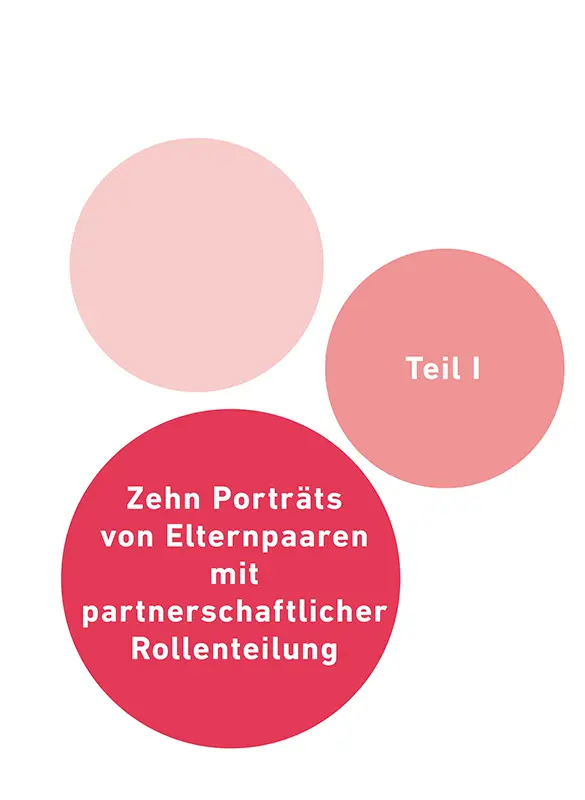
VORBEMERKUNGEN ZU DEN PORTRÄTS
»Seeing is believing«, meinte die Verhaltensökonomin Iris Bohnet in einer TV-Sendung:[3] Sehen heißt glauben. Was man sehen kann, entwickelt Überzeugungskraft. Das gilt auch für das Thema dieses Buchs. Die Skepsis gegenüber dem egalitären Rollenmodell ist nach wie vor groß. Junge Paare möchten es wählen, wagen es aber nicht aus Angst vor negativen Konsequenzen. Es braucht konkrete Vorbilder, die zeigen, dass das egalitäre Modell über einen längeren Zeitraum zur Zufriedenheit aller funktionieren kann.
Solche Vorbilder vermitteln die nachstehenden »Porträts«. Zehn Elternpaare berichten darin über ihren Alltag und halten Rückschau auf ihr Leben. Sie haben die egalitäre Rollenteilung über mehr als zwei Jahrzehnte praktiziert und wandelnden Bedürfnissen angepasst. Ihre Aussagen belegen den Erfolg des egalitären Modells, verschweigen aber auch dessen Schwächen und Schwierigkeiten nicht.
Die befragten Eltern haben sich bereit erklärt, im Buch mit Namen und Foto zu erscheinen. Sie haben die vorliegenden Texte zum Gegenlesen erhalten und für diese Publikation autorisiert. Der Zürcher Fotograf Reto Schlatter hat sie an ihrem Wohnort[4] – zusammen mit ihren Kindern und deren Partnerinnen und Partnern – im Bild festgehalten. Sie werden dadurch zu konkreten »role models«, an denen sich interessierte Paare orientieren können. Alle Altersangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des Interviews.
Ich stelle diese Porträts bewusst an den Anfang des Buchs. Sie sollen den Einstieg ins Thema erleichtern und zeigen, dass egalitäre Rollenteilung mehr ist als ein bloßes Forschungsthema. Sie ist gelebte Realität und – wie die vorgestellten Beispiele zeigen – langfristig eine Erfolgsgeschichte.
CAROLINE UND URS MENDELIN
»Im Haushalt hat sich einiges verändert, seit die Kinder groß sind«
Von der Haltestelle »Talwiesen« aus zu Fuß dem Höfliweg entlang. Links eine neuere Großüberbauung, rechts alte Reihenhäuser. Der Vorplatz von Haus Nr. 7 ist unspektakulär, die Briefkästen grau und alt. Beim Eintreten ein Gang mit Durchblick in den Keller, wo allerlei Geräte lagern. Oben die Wohnung der Mendelins. Sie wohnen nun schon über zwanzig Jahre hier und bilden mit anderen Wohnungsbesitzern eine Hausgemeinschaft.
Berufliche Entwicklung Beruflich haben sich gegenüber unserem letzten Gespräch vor zehn Jahren Änderungen ergeben. Caroline Mendelin (50) arbeitet nicht mehr im von ihr gegründeten Gestaltungsatelier mit, sondern hat eine Leitungsfunktion im Zürcher Lehrmittelverlag übernommen. »Das war ein Glücksfall«, erklärt sie. »Ich wusste, dass ich Karriere machen und in absehbarer Zeit eine Abteilung übernehmen kann.« Sie wollte diese Chance ergreifen und etwas Neues anpacken, auch im Hinblick auf die gemeinsame Perspektive. »Wir haben es als Versuch definiert«, erklärt Urs, »und wollten schauen, wie es funktioniert. Die Firma lief normal weiter, Caroline hätte auch wieder einsteigen können.«
Die neue Konstellation erhöhte die materielle Sicherheit – »es ist viel Existenzdruck von uns gewichen« –, zog aber auch Einschränkungen bezüglich Autonomie und Gestaltungsfreiheit nach sich. Urs Mendelin (53) ist nun allein in der Firma, lässt sich aber in gestalterischen Fragen weiterhin von seiner Frau beraten. Da ihm das Alleine-Arbeiten zu einsam wurde, suchte er Anschluss an eine Bürogemeinschaft. »Ich bin schon ein Einzelkämpfer«, begründet er, »aber das war zu viel. Jetzt habe ich ein gutes Umfeld.« Beide arbeiten nun in hohen Pensen. Für Caroline ist klar, dass sie beruflich Karriere gemacht hat. Für Urs war eine solche nie zentral. »Ich würde es als Entwicklung bezeichnen, nicht als Karriere.« Gleichwohl ist er mit seiner beruflichen Situation zufrieden. »Der Vorteil der Selbstständigkeit ist, dass ich meine Zeit selbst einteilen kann. Der Nachteil ist, dass ich – seit ich alleine bin – sehr schnell an meine Grenzen stoße. Wir haben ja viel miteinander gearbeitet und uns gegenseitig unterstützt. Jetzt muss ich alles selbst machen.«

Weiterbildungsbestrebungen Beide haben viel in Weiterbildung investiert und tun es heute noch. Caroline qualifizierte sich als »Multi Media Producer«, Urs als »Leiter Marketing / Kommunikation«. Um die Zukunft ihrer beruflichen Position zu sichern, absolviert Caroline eben eine Zusatzausbildung in Betriebswirtschaft. Urs bildet sich für die Herausforderungen im Internetbereich vor allem »on the job« weiter. »Der Wandel ist stetig, aber spannend. Wir haben nie etwas anderes gekannt. Darum ist es nichts, was mich überfordern würde.«
Rollenteilung und Hausarbeit Die Rollenteilung ist nach wie vor unbestritten, wurde aber an die neuen Gegebenheiten angepasst. Da Caroline ganztags auswärts arbeitet, ist Urs mehr im Haus präsent und auch stärker der Ansprechpartner für die Kinder und andere Angehörige. »Wenn ich im Geschäft bin«, betont Caroline, »kann ich mich nicht noch um Privates kümmern, das macht nun Urs.« Dieser präzisiert: »Im Haushalt hat sich einiges verändert, seit die Kinder groß sind und mithelfen. Das ist kein großer Aufwand mehr. Wir haben auch jemanden, der putzt; das ist eine große Entlastung.«
Rückblick auf die Anfänge der Rollenteilung Die Rückblende auf 25 Jahre partnerschaftlicher Rollenteilung spannt einen weiten Bogen: Urs ist in einer Familie mit traditioneller Rollenteilung aufgewachsen, Caroline als Tochter einer alleinerziehenden Mutter. »Meine Eltern sind geschieden und lebten in zwei Welten. Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht in ein solches Zweiweltenmodell hineinrutschen möchte.« Der Anstoß für die egalitäre Rollenteilung kam denn auch von Caroline. »Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich schwanger war und wir unsere Zukunft planten. Wir haben miteinander vereinbart, dass wir Beruf und Familie teilen. Das haben wir ganz bewusst zusammen entschieden, und das haben wir auch durchgezogen.«
Zum Zeitpunkt der Familiengründung arbeiteten die beiden im Jobsharing (je 60 Prozent) als Typografen in einem grafischen Atelier. Sie machten damals im eigentlichen Sinne »halbe-halbe«. Urs arbeitete von Montag bis Mittwochmittag, Caroline von Mittwochnachmittag bis Freitagabend. Wer zu Hause war, war für Haushalt und Kinder verantwortlich. Am Mittwochnachmittag übernahmen die Großmütter die Kinderbetreuung, damit die Arbeit im Geschäft reibungslos übergeben werden konnte. So war es möglich, ohne institutionelle Kinderbetreuung auszukommen.
Urs fand seine Situation als Teilzeit arbeitender Vater nicht immer einfach. Im Geschäft nahm man eher die Nachteile als die Vorteile der Teilzeitarbeit zur Kenntnis (organisatorischer Mehraufwand usw.). Es erstaunte ihn auch, wenn Kollegen zu ihm sagten: »Oh, morgen hast du ja frei!« Als ob Familienarbeit bloße Freizeit wäre. Auf dem Spielplatz war er oft der einzige Mann; damals war das noch außergewöhnlich.
Caroline hingegen war mit der Rollenteilung sehr zufrieden. Nach der Geburt des ersten Kindes hatte sie es belastend gefunden, ausschließlich zu Hause zu sein. Schließlich hatte sie noch eine Zusatzausbildung absolviert und war deshalb an der Fortsetzung der Erwerbsarbeit sehr interessiert. Sie erkannte auch, dass es unmöglich ist, das volle Verständnis für die Arbeit des Partners zu entwickeln, wenn man selbst nicht berufstätig ist.
Читать дальше