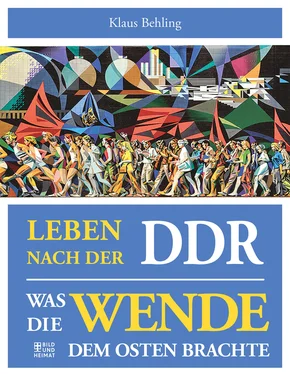Wolfgang Ullmann, Mitbegründer der Oppositionsgruppe »Demokratie Jetzt«, machte den Vorschlag am 12. Februar 1990 öffentlich. Der Runde Tisch fasste einstimmig den Beschluss, dass die Modrow-Regierung bis zum 1. März eine entsprechende Vorlage zu erarbeiten habe. Nun wurde die Idee auch im Westen diskutiert. Weshalb die DDR-Oppositionellen eine »Treuhand« für nötig hielten, beschrieb die Frankfurter Allgemeine am 15. März 1990: »In der Bildung der Treuhandanstalt sieht Ullmann einen wichtigen Schritt zur Sicherung der Rechte und des Eigentums der Bürger. Auf eine Enteignung der Bürger würde es hinauslaufen, wenn das von ihnen erarbeitete und eigentlich auch ihnen gehörende Volkseigentum als Staatseigentum behandelt würde.«

Der Theologe Wolfgang Ullmann (rechts) bei einer Sitzung des Zentralen Runden Tisches Ende Januar 1990 im Berliner Schloss Niederschönhausen. Gemeinsam mit dem Regisseur Konrad Weiß (links) und der Bürgerrechtlerin Ulrike Poppe gründet er 1989 die Bewegung »Demokratie Jetzt«. Nach der Wahl am 18. März 1990 wird er Abgeordneter der Volkskammer und deren Vizepräsident als Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Grüne. (picture alliance / dpa – Report / Peter Zimmermann)
Dementsprechend legte die erste Treuhandverordnung fest: »1. Zur Wahrung des Volkseigentums wird mit Wirkung vom 1. März 1990 die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums gegründet.« Wie mit dem Eigentum weiter zu verfahren sei, blieb offen: »Bis zur Annahme einer neuen Verfassung wird die Treuhandanstalt der Regierung unterstellt.«
An den sozialistischen Grundlagen der DDR wollte die Regierung Modrow damit nicht rütteln. Deshalb bestimmte die Treuhandverordnung, welche Vermögensteile betroffen waren, und schloss »das volkseigene Vermögen, das sich in Rechtsträgerschaft der den Städten und Gemeinden unterstellten Betriebe und Einrichtungen befindet, sowie das volkseigene Vermögen der als Staatsunternehmen zu organisierenden Bereiche und durch LPG genutztes Volkseigentum« aus. Die gesamte Infrastruktur – Post, Bahn, Wasserwege und Straßen – wurde zum »Sondervermögen«. Da die Gesetzgebung auf der Grundlage der geltenden DDR-Verfassung erfolgte, blieben auch Grund und Boden »unteilbar und unveräußerlich«.
Trotz erster Schritte auf dem Weg in eine Marktwirtschaft konnte die Treuhand bis zum 18. März 1990 kaum umfänglich als »Umbauagentur« wirken. Vor der Veränderung der dazu ungeeigneten Struktur stand für die neue Regierung unter der Führung der CDU zuerst ein neuer politischer Auftrag der Anstalt. Das am 17. Juni 1990 verabschiedete »Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens« formulierte als »Absicht« der Treuhandanstalt:
»• die unternehmerische Tätigkeit des Staates durch Privatisierung so rasch und so weit wie möglich zurückzuführen,
• die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen herzustellen und somit Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen,
• Grund und Boden für wirtschaftliche Zwecke bereitzustellen.«
Dieser Schwenk um hundertachtzig Grad entsprach dem Wunsch nach einer schnellen Einheit. Was nach dem Krieg von der Gründergeneration der DDR gern als »Revolution« interpretiert wurde, machte das Treuhandgesetz nun rückgängig. Paragraph 1, Vermögensübertragung, legte fest: »(1) Das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren …« Damit wurde die Treuhand, je nach Blickwinkel, für die einen die tatsächliche »Revolution« des Herbstes 1989, für die anderen jedoch zur »Konterrevolution«.
Zum Treuhanderlös bestimmte Paragraph 5: »(1) Die Einnahmen der Treuhandanstalt werden vorrangig für die Strukturanpassung der Unternehmen … [und] in zweiter Linie für Beiträge zum Staatshaushalt und zur Deckung der laufenden Ausgaben der Treuhandanstalt verwendet.«
Das sollten künftig Kapitalgesellschaften besorgen. Paragraph 7 legte fest: »(1) Die Treuhandanstalt verwirklicht ihre Aufgaben in dezentraler Organisationsstruktur über Treuhand-Aktiengesellschaften, die nach Anzahl und Zweckbestimmung mit den Aufgaben der Treuhandanstalt die Privatisierung und Verwertung des volkseigenen Vermögens nach unternehmerischen Grundsätzen sichern.«
Überdies hatte sie die Anpassung an die Wirtschaftsstruktur der alten Bundesrepublik zu schaffen. Paragraph 8: »(1) Die Treuhand-Aktiengesellschaften haben unter Hinzuziehung von Unternehmensberatungs- und Verkaufsgesellschaften sowie Banken und anderen geeigneten Unternehmen zu gewährleisten, dass in ihrem Bereich folgende Aufgaben unternehmerisch und weitestgehend dezentral gelöst werden:
• Privatisierung durch Veräußerung von Geschäftsanteilen oder Vermögensanteilen,
• Sicherung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen,
• Stilllegung und Verwertung des Vermögens von nicht sanierungsfähigen Unternehmen oder Unternehmensteilen.«
Damit war eine Konstruktion gefunden, mit der einerseits die DDR-Wirtschaft kompromisslos an die der Bundesrepublik angepasst wurde, gleichzeitig aber keine »Staatsholding« entstand. Das verhinderte später die »Durchgriffshaftung«, also das Einstehen des Eigentümers Treuhandanstalt für Fehler. Andererseits »regierte« sie in die ostdeutschen Betriebe hinein, denn jeder Pfennig, den diese brauchten, konnte nur von der Treuhand kommen. Wie eine »Konzernmutter« hielt sie alle Fäden in der Hand, war aber nicht verantwortlich, wenn etwas schiefging.
Vor diesem Hintergrund relativierte sich der Paragraph 2, Punkt 6, des Treuhandgesetzes: »(6) Die Treuhandanstalt hat die Strukturanpassung der Wirtschaft an die Erfordernisse des Marktes zu fördern, indem sie insbesondere auf die Entwicklung sanierungsfähiger Betriebe zu wettbewerbsfähigen Unternehmen und deren Privatisierung Einfluss nimmt. Sie wirkt darauf hin, dass sich durch zweckmäßige Entflechtung von Unternehmensstrukturen marktfähige Unternehmen herausbilden und eine effiziente Wirtschaftsstruktur entsteht.«
Festzuhalten bleibt also: In den Monaten vor und dem ersten halben Jahr nach der Einheit dachte man an einen Umbau der DDR-Wirtschaft, nicht an deren Kahlschlag. Lothar de Maizière resümierte dazu im Nachhinein über die Rolle der Treuhand: »Sie hatte ein unerreichbares Ziel.«
So sahen es die Leute mit dem Geld in der Hand wohl schon früher. Das belegen ihre Aktivitäten. Danach blieb der Treuhand nur noch, ihre Polemik an die Realität anzupassen. Nun hieß es: »Privatisierung ist die beste Sanierung.« Und: Die Anstalt habe drei Aufgaben in der Rangfolge ihrer Bedeutung: »Schnelle Privatisierung – entschlossene Sanierung – behutsame Stilllegung«.
Waren die »treuen Hände« schmutzig?
Ja, sagen viele, die Anfang der 1990er Jahre durch die Treuhandaktivitäten ihre Arbeit verloren. Oft kamen sie nie wieder so richtig auf die Beine. Das spüren die Betroffenen heute an ihrer Rente. Ja, sagen auch manche Politiker und verweisen auf den bis heute weitgehend deindustrialisierten Osten. Im Fernsehen sind Berichte über besonders dreisten Betrug zu sehen. Die Darstellung von Treuhandverkäufen ganzer Firmenkomplexe für 1 DM soll illustrieren, dass das alles gar nicht mit rechten Dingen zugehen konnte. Es gibt sogar konkrete Zahlen. Am 17. Januar 1994 informierte Bundesfinanzminister Theo Waigel den Deutschen Bundestag: »In den der Stabsstelle ›Besondere Aufgaben‹ des Direktorates Recht der Treuhandanstalt bisher bekanntgewordenen Fällen von Vereinigungskriminalität beläuft sich der strafrechtlich – nicht betriebs- oder volkswirtschaftlich – relevante Schaden, das heißt der Schaden, der auf tatbestandsmäßigen, rechtswidrigen und schuldhaften Handlungen beruht, an die das Gesetz eine Strafandrohung knüpft und für die ein Anfangsverdacht besteht, auf rund 3 Mrd. DM – Schaden der Treuhandanstalt ca. 1,84 Mrd. DM, Schaden von Treuhand-Unternehmen ca. 961 Mio. DM, Schaden von Dritten ca. 207 Mio. DM. Dank der erfolgreichen Tätigkeit der verschiedenen Kontrollorgane der Treuhandanstalt konnte der tatsächlich eingetretene Schaden allerdings auf rund 300 Mio. DM begrenzt werden.«
Читать дальше