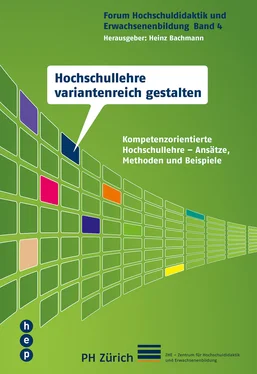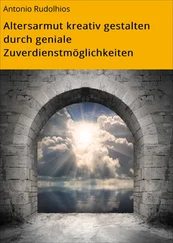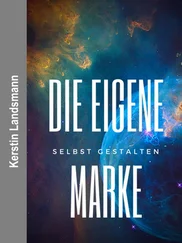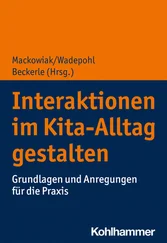Im nächsten Kapitel ist dargelegt, was hier unter Kooperativem Lernen genau verstanden wird und welche Unterscheidung zwischen kooperativem und kollaborativem Lernen sowie der herkömmlichen Gruppenarbeit (Abschnitt 2.1) getroffen werden kann. Daran anschließend erfolgt eine kurze Übersicht über die theoretische Rahmung Kooperativen Lernens (2.2). Das nächste Kapitel bietet eine Übersicht über die Grundlagen und Besonderheiten Kooperativen Lernens anhand der wichtigsten Merkmale (Kapitel 3). Nach der Beschreibung dreier Instruktionsarten (Kapitel 4) werden im Hauptteil dieses Aufsatzes (Kapitel 5 und 6) konkrete Hinweise für die Praxis gegeben sowie Vorgehensweisen und Strategien dargestellt. Zusammenfassende Gedanken runden den Artikel ab.
2Wofür steht der Begriff «Kooperatives Lernen»?
Kooperation dient als Schmierstoff für jene Maschinerie, mit deren Hilfe wir es schaffen, dass Dinge getan werden, und indem wir uns mit anderen Menschen zusammentun, können wir individuelle Mängel ausgleichen.
Richard Sennett (2012, S. 9)
Unter dem Titel Zusammenarbeiten zeigt Sennett (2012) in seinem neusten Buch auf, dass die für eine komplexe Gesellschaft unerlässlichen Kooperationsfähigkeiten an Bedeutung verlieren. In den letzten Jahren werden in Weiterbildungsveranstaltungen sowie im Hochschulbereich immer häufiger Online-Foren für den internen Austausch angeboten. Mehrere Personen, die örtlich voneinander getrennt sind, kommunizieren über das Internet miteinander und lösen ein spezifisches Problem, indem gemeinsame Wissensressourcen genutzt werden. In diesen Online-Lerngemeinschaften stehen für die Beteiligten meist der Erwerb und der Austausch von Wissen im Vordergrund. Auch wenn diese virtuellen Gruppen durch E-Moderation und durch spezielle reflexionsfördernde Software unterstützt werden, bieten sie keinen Ersatz für eine Gruppe vor Ort, in der gemeinsames Denken, Aushandeln und Entscheiden sowie die Weiterentwicklung sozialer und kooperativer (Lern-)Kompetenzen stattfinden. Nach Sennett (ebd., S. 42–49) beschränken und behindern Programme der Online-Kommunikation wie z.B. Google Wave die Kooperation, da die Kooperationsfähigkeit des Menschen weitaus größer und komplexer ist, als es die technischen Tools zulassen. «Man könnte sagen, die Programmierer erlaubten es den Benutzern nicht, miteinander Interaktionsmöglichkeiten zu erproben, wie es beispielsweise während musikalischer Proben geschieht» (ebd., S. 48). Erschwerend kommt hinzu, dass in der modernen Gesellschaft die Organisation der Kommunikation durch dialektische Argumentation vertrauter und verbreiteter ist als die Gestaltung der dialogischen Diskussion. Im vorliegenden Artikel interessieren die konkreten Möglichkeiten Kooperativen Lernens in der Lehre mit Fokus auf Interaktion und Dialog.
Kooperatives Lernen ist auch Ausdruck eines Wandels der Lehr-Lern-Kultur: weg von der Fremdsteuerung und der Nachkonstruktion durch die Lehrenden hin zur Erkenntnis, dass nur das gelernt wird, was selbst aktiv und interaktiv angeeignet wurde. Auch in der tertiären Ausbildung verschiebt sich der Schwerpunkt von der Wissensakkumulation und -reproduktion auf die Vermittlung von Methoden und Strategien wie neustes Wissen erschlossen, überprüft und auf spezielle Problemstellungen anwendbar gemacht werden kann. Dieser lerntheoretische Paradigmenwechsel wird beim Kooperativen Lernen deutlich erkennbar. Da Wissen und Handeln kontextgebunden sind, müssen zudem Lernsituationen angeboten werden, in denen nach Konrad und Traub (2001) eigene Konstruktionsleistungen möglich sind, in denen kontextgebunden gelernt werden kann. Je mehr die Lernsituation der Anwendungssituation entspricht, umso eher kann dieser Anspruch eingelöst werden. Auch an Hochschulen müssen vermehrt Situationen realitätsnahen Lernens (vgl. auch fallbasiertes und forschungsorientiertes Lernen im Beitrag von Bieri et al.) geschaffen werden, um die Studierenden auf die Berufswelt vorzubereiten und sie zum Weiterlernen zu befähigen.
Mit den meisten handlungsorientierten und realitätsnahen Lern- und Bildungsformen sind auch kooperative Lernprozesse angesprochen. So etwa beim projektorientierten Lernen oder auch beim problembasierten Lernen (Beitrag von Müller). Zudem stellt Kooperatives Lernen auf Fach(hoch)schulebene einen viel versprechenden Ansatz dar, um die Qualität der Lehr-Lern-Prozesse zu verbessern und die Umstellung hin zur Lern- und Kompetenzorientierung zu unterstützen. Die Partizipation und Integration von Studierenden in das Lehrgeschehen ist eingebettet in eine Kultur des Lernens, welche die gesamte Organisation betrifft (Beitrag von Tanner). Das heißt zum Beispiel, dass auch Dozierende ihre Lehre kooperativ und kollaborativ entwickeln und reflektieren.
2.1Kooperatives Lernen, Kollaboratives Lernen oder Gruppenarbeit?
In manchen Fällen wird in der Literatur Kooperatives Lernen als eine spezifische Form des Kollaborativen Lernens betrachtet (Huber 2006). Dann wiederum werden die beiden Lernformen als zwei unterschiedliche Ansätze und Traditionen bezeichnet, die zwar grundlegende Übereinstimmungen aufweisen, sich jedoch in verschiedene Richtungen entwickelt haben. So soll sich das Kollaborative Lernen eher auf Hochschulebene etabliert haben, während sich die Grundlagenliteratur des Kooperativen Lernens auf den Primär- und Sekundarschulbereich bezieht. Unbestritten ist, dass Methoden des Kooperativen Lernens auch für den Gebrauch an der Hochschule adaptiert und übernommen wurden. Und diese Methoden sind zum Teil sehr gut erprobt und beforscht (Gruppenpuzzle, Abbildung 3oder STAD, Abbildung 4).
In der Literatur ist man sich einig, dass sich das Kooperative Lernen vom Kollaborativen Lernen in seiner stärkeren Strukturierung unterscheidet und als strukturierte systematisierte Lernform bezeichnet werden kann. Die Lehrenden sind einflussreicher involviert, machen mehr Vorgaben, beobachten die Gruppenarbeit und steuern und evaluieren die Beteiligung der Einzelnen stärker. Häufig nehmen sie die Einteilung der Gruppen vor oder steuern diese mit, indem beispielsweise auf Kriterien der Zusammensetzung aufmerksam gemacht wird. Auch dass die Studierenden dazu angehalten werden, über das Funktionieren der Zusammenarbeit in der Gruppe zu reflektieren und Entwicklungs- und Verbesserungsmöglichkeiten zu überlegen, gehört dazu. Ein grundlegender Unterschied ist zudem, dass beim Kooperativen Lernen Leistungen auch individuell beurteilt werden und nicht nur kollektiv, indem ausschließlich das Endprodukt bewertet wird. Zwischen den Gruppenmitgliedern besteht zwar eine positive gegenseitige Abhängigkeit, das heißt, die Zusammenarbeit in der Gruppe ist für den Erfolg der Einzelnen notwendig. Die Lernenden sind jedoch individuell verantwortlich für ihr Lernen und ihr Engagement in der Gruppe.
Da sich die Zusammenarbeit in Gruppen in einer Art Sandwich-Prinzip mit anderen Lernformen kombinieren lässt, schließt der Ansatz des Kooperativen Lernens weder die frontal ausgerichtete Lehre noch Sequenzen selbstverantworteten Lernens aus. Beim Kollaborativen Lernen hingegen bleiben Gruppen über längere Zeit zusammen, bearbeiten ein gemeinsames Projekt oder eine gemeinsame Fragestellung wie beispielsweise im forschungsorientierten Lernen und Lehren. In anderen Fällen treffen sich die Mitglieder solcher Langzeit-Studierendenteams regelmäßig außerhalb des Unterrichts, um gemeinsam zu lernen, zu lesen, zu wiederholen, Aufgaben zu erledigen, Texte gegenzulesen etc. Diese Form der Zusammenarbeit findet meist in selbst organisierter Form statt, ohne aktive Unterstützung und Steuerung von Lehrenden. Für die Lehre an Hochschulen sind beide Formen relevant und von Interesse – sie haben zum Ziel, dass Lernende nicht nur zusammenarbeiten, sondern dass sie im besten Fall gemeinsam mehr und anderes lernen als allein. Durch Kooperatives Lernen kann das Leistungsniveau aller Beteiligten und somit deren Selbstvertrauen gesteigert werden. Ebenso lernen die Studierenden produktives Zusammenarbeiten und werden in einer Wissensgemeinschaft sozialisiert.
Читать дальше