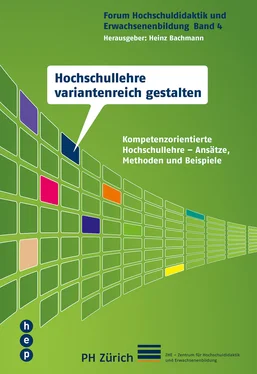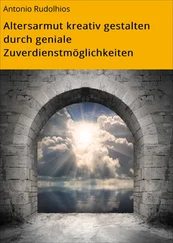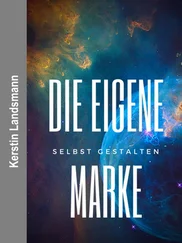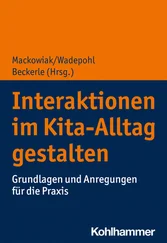4.1Kompetenzbeschreibungen
4.2Einführung in die Studienganggestaltung
4.3Empfehlungen zur Studienganggestaltung
5Projektstudio und Fachstudio
6Fazit
Christian Adlhart Problembasiertes Chemie-Grundlagenpraktikum – verändertes Menschenbild als Ausgangspunkt zur Neugestaltung der Lehre
1Einleitung
2Theorie X von McGregor
3Hintergrund: vom Chemielaboranten zum Chemiestudenten
4Das traditionelle erklärende Chemie-Grundlagenpraktikum
5Das problembasierte Chemie-Grundlagenpraktikum
6Umsetzung eines projektbasierten Chemie-Grundlagenpraktikums
6.1Fragestellung/Projektwahl
6.2Schritt 1: Verstehen/Übersetzen
6.3Schritt 2: Konzeption
6.4Schritt 3: Umsetzung
6.5Schritt 4: Auswerten
6.6Bericht/Vortrag
7Erfahrungen bei der Umsetzung
7.1Regelmäßige Evaluationen ergeben ein heterogenes Bild
7.2Learning Outcomes
7.3Teambuilding
7.4Die Rolle der Assistierenden und Dozierenden
7.5Organisation und Ressourcen
8Zusammenfassung
Margot Tanner Non-Technical Skills for Engineers (NoTechS) – Ganzheitliche Kompetenzförderung für die reale Arbeitswelt
1Einführung – Vorbereitung auf komplexe Arbeitswelten
2Grundannahmen des NoTechS-Ansatzes
2.1Sozial- und Selbstkompetenz – alles bloß gesunder Menschenverstand?
2.2Sozial- und Selbstkompetenz – dynamisch veränderbar oder statisch gegeben?
2.3Eine kompetente Person
2.4(Selbst-)Reflektieren im ingenieurtechnischen Denk- und Handlungsmuster
2.5Kompetenzentwicklung
2.6Leistungsnachweis der Kompetenzentwicklung
3Das konsolidierte NoTechS-Konzept im konkreten Studienalltag
3.1NoTechS-Grundsätze
3.2Lernziel- und Kompetenzenkatalog NoTechS
3.3Stoßrichtung und Schwerpunkte der NoTechS-Förderung
3.4Integration des NoTechS-Ansatzes in die Projektschiene
4NoTechS-Fortbildung der Dozierenden
Johannes Breitschaft, Rita Tuggener Großgruppenveranstaltungen erfolgreich gestalten
1Einleitung
2Die Vorlesung als besondere Form des Lernens in Großgruppen
2.1Kritischer Blick auf die Vorlesung
2.2Aussagen aus der Praxis zu gelungenen Vorlesungen
2.3Grundlegende Erkenntnisse in Bezug auf das Lernen: vom Begreifen zum Behalten
2.4Das Fundament: Planung einer Vorlesungsreihe
2.5Das Detail: Planung und Durchführung einer Vorlesung
2.6Blended Dialog als Gefährte der Vorlesung
2.7Dozierendenverhalten in Vorlesungen
3Alternative Großgruppenmethoden im Kontext der Hochschuldidaktik
3.1Allgemeines zu Großgruppen in diesem Kontext
3.2Open Space Technology
3.3Das World Café
3.4Checkliste für die Vorbereitung und Durchführung einer Großgruppenveranstaltung
4Methodenkoffer im Rahmen eines Großgruppensettings
4.1Kreative Vorlesungsmethoden
4.2Kreative Kleingruppenmethoden im Rahmen eines Großgruppensettings
5Zusammenfassung
Heinz Bachmann Zündende Ideen – eine Website für Good Practices in der Hochschullehre
1Einleitung
2Warum eine Website?
3Prämierte Lehre – Nutzung in hochschuldidaktischen Veranstaltungen
4Prämierte Lehre – ein Ausgangspunkt zur Reflexion der Hochschullehre
4.1Aussagen von Studierenden zu ihren Dozierenden
5Schlussfolgerungen
Autorenspiegel
Vorwort zur Reihe Forum Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung
Dozierende an Hochschulen lehren, prüfen, beraten, forschen, organisieren Wissens- und Technologietransfer durch Weiterbildung und Dienstleistungen, betreiben Projektmanagement und engagieren sich in der Qualitätsentwicklung der eigenen Hochschule.
Lehre und Unterricht an Hochschulen und die Hochschulentwicklung sind zudem durch die Umsetzung der Bologna-Deklaration besonders herausgefordert: Dozierende gestalten gemeinsam Curricula oder einzelne Module, planen Leistungsnachweise, integrieren Phasen von selbstorganisiertem Lernen oder implementieren Konzepte wie Problem-based Learning in ihren Lehrveranstaltungen.
Das ZHE Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung wurde 2009 an der Pädagogischen Hochschule Zürich gegründet und unterstützt Hochschulen und ihre Dozierenden bei den oben beschriebenen Herausforderungen durch Weiterbildung und Beratung.
Themenschwerpunkte des ZHE sind u.a. Studierendenorientierung, Rollenvielfalt bei Dozierenden, kompetenzorientierte Lehre, erwachsenenbildnerisches Handeln in der Lehre an Hochschulen und Hochschulentwicklung.
Mit der Reihe Forum Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung haben wir uns zum Ziel gesetzt, Diskussionen und Auseinandersetzungen um aktuelle und praxisrelevante hochschuldidaktische Fragen anzuregen sowie Dozierenden an Fachhochschulen sowie Aus-/Weiterbildungsverantwortlichen in weiteren Institutionen der Erwachsenenbildung nützliche Reflexions- und Handlungsinstrumente zur Verfügung zu stellen.
Jeweils eine Person oder ein Team aus dem ZHE oder dessen Umfeld verantwortet als Herausgeber einen Band; wir planen mindestens zwei Publikationen pro Jahr.
Wir haben uns für den vierten Band dazu entschieden, aus diversen Disziplinen verschiedene methodische Zugänge der Hochschullehre zu beleuchten und dadurch mögliche Umsetzungen von kompetenzorientierter Lehre aufzuzeigen.
Herausgeber dieses Bandes ist Heinz Bachmann, langjähriger Leiter des Lehrganges für Hochschuldidaktik am ZHE.
Als nächster Band (5) geplant ist für das Jahr 2014:
Leadership in der Hochschullehre: Denkanstösse für die Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben an der Schnittstelle von Didaktik und Management
Beste Grüsse
Prof. Dr. Geri Thomann, Leiter ZHE Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung
geri.thomann@phzh.ch
http://hochschuldidaktik.phzh.ch/
Heinz BachmannAktivierende Hochschullehre – kompetenzorientierte Hochschullehre variantenreich gestalten
Einführung – kompetenzorientierte Hochschullehre
Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Was offensichtlich schon Goethe umtrieb – die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln – ist bis heute ein Thema geblieben, das in den letzten Jahren verstärkt auch die Hochschulen beschäftigt. In der Sprache der Lernpsychologie verwendet man dafür den Begriff des trägen Wissens. Die Psychologen Gabi Reinmann und Heinz Mandl (2006) umschreiben dabei die Erfahrung, dass Studierende immer mehr wissen, aber zunehmend weniger in der Lage sind, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Diese Kluft zwischen Wissen und Handeln hat sich nicht zuletzt mit der Verbreitung des Internets verschärft. Die ungeheure Menge an verfügbarer Information führt zu einem Stoffdruck in der Hochschullehre, der die Studierenden zu oberflächlichem Lernen verführt. Beim Oberflächenlernen konzentrieren Lernende sich darauf, in kurzer Zeit möglichst viel Stoff auswendig zu lernen und vernachlässigen dabei das Verstehen, Anwenden und Vernetzen mit bereits gelerntem Wissen und Können. Die Überlegungen im nächsten Abschnitt sind dem Band «Kompetenzorientierte Hochschullehre» (Bachmann 2011) entnommen.
Die vielfach diskutierte Wissensexplosion und die damit verbundene zunehmend kürzere Halbwertszeit von Spezialwissen führen zu einer Schwerpunktverschiebung in der Hochschullehre. Zusätzlich zur reinen Informationsvermittlung, der nach wie vor noch sehr wichtigen Schulung von Fachkompetenz, geht es mehr und mehr darum, neben dem fachlichen Denken auch Problemlösefähigkeiten zu üben und das eigene Lernen zu thematisieren (überfachliche Kompetenzen). Die wachsende Komplexität in der Forschung und Arbeitswelt hat zur Folge, dass Problemstellungen immer häufiger nur in Zusammenarbeit mit Personen aus anderen Fachbereichen gelöst werden können. Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Ausdauer, Belastbarkeit und Selbstorganisation spielen dabei eine zunehmend wichtigere Rolle. Die genannten überfachlichen Kompetenzen können bei den Studierenden nicht einfach vorausgesetzt werden. Sie sind gezielt zu fördern. Im ECTS Users’ Guide heißt es zur Kompetenzschulung (2009, S. 15):
Читать дальше