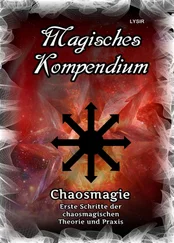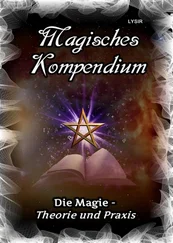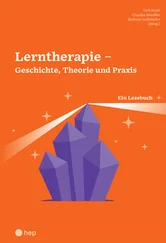Hinsichtlich der gedruckten Dokumente einer klösterlichen Musiksammlung wird die Frage der Bewertung bei der Sammlungstektonik relevant. Als Speicher interkultureller Prozesse haben Klöster seit dem 17. Jahrhundert nicht nur systematisch Notendrucke erworben, sondern sind selber als Notendrucker und Verleger aktiv gewesen. Dies zeigen Notendrucke aus der Benediktinerabtei Einsiedeln 29oder aus der Fürstabtei St. Gallen. 30Klösterliche Musiksammlungen repräsentieren somit auch die Geschichte des Notendrucks mit dem Typendruck (16.–18. Jahrhundert), dem Notenstich (Ende 18. Jahrhundert und erste Hälfte 19. Jahrhundert) und der für die Notenpublikation entscheidenden Erfindung des lithographischen Notendrucks durch Aloys Senefelder 1797/98. In ihrer Weiterentwicklung zu Beginn des 19. Jahrhunderts und unter der Federführung des Verlegers Johann André hat Senefelders Erfindung die bisherige Exklusivität der Notenpublikation (kleine Auflagezahlen) aufgehoben 31und zu einer Verbilligung des Herstellungsprozesses von Notendrucken geführt. Sie «revolutionierte» zudem das Musikverlagswesen und die Druckproduktion: Notendrucke von Novitäten kamen viel schneller und in grösserer Stückzahl auf den Markt und sind in klösterlichen Musiksammlungen des Öfteren in Mehrfachexemplaren anzutreffen. Hinter dieser «Kumulation» steht die klösterliche Musikpflege, die gekennzeichnet ist durch das Interpretieren der Werke – daher die Notwendigkeit der Mehrfachexemplare – und durch die eigene Musikproduktion (Komposition). Senefelders Erfindung ermöglichte es, dass Klöster ihre Musikproduktion nunmehr in grösserer Stückzahl selber herausgaben oder dabei mit ihnen nahestehenden Verlegern und Druckern eng zusammenarbeiteten. Als Beispiel hierfür seien die zahlreichen Veröffentlichungen der Gebrüder Benziger 32in Einsiedeln erwähnt. Durch die Expansion ihres Betriebs erfuhren die Werke der Einsiedler Klosterkomponisten des 19. Jahrhunderts eine grosse Verbreitung in Deutschland und in den Vereinigten Staaten.
Für die Bewertung der Drucke innerhalb der Tektonik der Musiksammlung ist die Kenntnis dieser produktionsgeschichtlichen Zusammenhänge von zentraler Bedeutung. Drucke, die einem solchen Prozess entsprungen sind, dokumentieren nicht nur den künstlerisch-ästhetischen Wert einer Komposition, sondern sind auch Zeugen einer Herausgeber- und Verlegertätigkeit, die unabhängig vom Erscheinungsjahr einen intrinsischen Wert besitzen und deshalb bei der Tektonik der Sammlung dem historischen Quellenbestand zuzuordnen sind. Ebenso gehören die vor 1800 erschienenen Notendrucke 33dem historischen Quellenbestand an, deren Auflagezahl bereits beim Erscheinen gering war und deren heutige Überlieferung auch aufgrund von Verlusten als klein betrachtet werden muss.
Bewertung der Musiksammlung des Benediktinerklosters Mariastein
Bei der Bewertung stand die Tektonik der Sammlung im Zentrum. Für die Bewertungsentscheide wurden neben den im theoretischen Diskurs erläuterten Aspekten die Tektoniken anderer klösterlicher Musiksammlungen konsultiert.
Die handschriftliche Überlieferung musikalischer Werke, die vor der Reorganisation über das ganze Sammlungsgut verstreut waren, hat einen intrinsischen Wert. Sie umfasst Werke von Klosterkomponisten, ein Autograph von Wolfgang Amadeus Mozart sowie in Mariastein entstandene Abschriften von Werken der europäischen Musikgeschichte von 1750 bis ungefähr 1960, die für die klösterliche Musikpflege hergestellt wurden. Bei der Reorganisation wurde diese Überlieferung daher vollumfänglich als archivwürdig bewertet und als Teilbestand «Musikarchiv» neu aufgebaut. Zum Teilbestand «Musikarchiv» gehören in der Musiksammlung von Mariastein aber auch Drucke. Dabei handelt es sich einerseits um Notendrucke, die vor 1800 publiziert wurden und die gemäss internationalem Standard des RISM als historische Quellen 34zu bewerten sind. Im Weiteren wurden dem Teilbestand «Musikarchiv» alle Notendrucke von Mariasteiner Klosterkomponisten zugeordnet. Deren Druckproduktion wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit durch das Kloster veranlasst. Dazu zählen auch die Werke des Klosterkomponisten und nachmaligen Abtes P. Leo Stöcklin (1803–1873), die nicht den Weg in grosse Verlagshäuser fanden, sondern in Druckereien des benachbarten Umlandes (Elsass oder Süddeutschland 35) produziert wurden. Ein weiteres Kriterium für die Übernahme von Drucken in den Teilbestand «Musikarchiv» bilden Editionen, die einen Widmungsvermerk an Mariasteiner Konventualen enthalten oder als Erstdrucke von Komponisten, welche die europäische Musikgeschichte nachhaltig geprägt haben. Dazu zählen beispielsweise die Partitur der «Missa Solemnis» op. 123 von Ludwig van Beethoven, die im Todesjahr von Beethoven 1827 beim Verlagshaus Schott in Mainz publiziert wurde, oder der Erstdruck der «Grande Messe des Morts dédiée à Mr. Le Comte de Gasparin Pair de France et composée par Hector Berlioz» op. 5, der 1838 bei Maurice Schlesinger in Paris erschien. Geschenkt wurde dieser Erstdruck den Benediktinern von Mariastein vom Onkel des Komponisten Colonel Marmion, dem Bruder von Berlioz’ Mutter Marie-Antoinette-Josephine Marmion; darauf verweist die handschriftliche Widmung auf der Titelseite.
In der Musiksammlung befinden sich nunmehr Musikdrucke, die nach den Bewertungskriterien
— Erscheinungsdatum vor 1800,
— Mariasteiner Klosterkomponist,
— Erstdrucke von Komponisten bis ca. 1850,
— Drucke, die vom Kloster in Auftrag gegeben wurden
dem Teilbestand «Musikarchiv» zugeordnet wurden. Alle anderen Notendrucke bilden den Teilbestand «Notenbibliothek». Innerhalb dieses Teilbestands wurde das Provenienzprinzip über das Pertinenzprinzip gestellt; das heisst, der Aufbau des Notenbestandes der Bibliotheca Benedictinorum (Herkunft Kollegium Karl Borromäus, Altdorf) wurde unverändert in den Teilbestand eingegliedert, obwohl aus bibliothekswissenschaftlicher Perspektive für diese Materialien eine alphabetische oder sachthematische Gliederung nach musikalischen Gattungen sinnvoller erscheint. Bei den Notenmaterialien jüngeren und jüngsten Datums, die keiner eindeutigen Provenienz zuzuordnen sind, wurde der Sammlungsaufbau durch die sachthematische Gliederung der musikalischen Gattung bestimmt (Pertinenz).
Diese Bewertungsmatrix für Notendrucke ist auf die Mariasteiner Musiksammlung zugeschnitten. Im Gegensatz zu anderen Musiksammlungen, in denen hinsichtlich der Bewertung lediglich zwischen handschriftlicher Überlieferung und gedruckter Produktion unterschieden wird, sind in Mariastein nun auch für die Notendrucke differenzierte Bewertungen erstellt worden. Bewertungen von Notendrucken sind in Musiksammlungen selten anzutreffen. Das liegt in erster Linie daran, dass Notendrucke des 19. Jahrhunderts nicht mit Publikationsdatum versehen sind, sondern mit Verlags- beziehungsweise Druckplattennummern. Eine zeitliche Abgrenzung für die Bewertung als «historische Quelle» ist daher nur über den Weg der Verzeichnisse von Verlagsnummern einzelner Verlage oder durch den «Musikalisch-literarischen Monatsbericht neuer Musikalien, musikalischer Schriften und Abbildungen» 36möglich, welchen der Leipziger Verleger Friedrich Hofmeister (1782–1864) und seine Nachfolger von 1829 bis 1900 monatlich veröffentlichten. Durch diese Publikation sind ca. 330 000 musikalische Neuerscheinungen nach Monat und Jahr dokumentiert und können bei der Erschliessung zur Datierung der Publikation herangezogen werden. Die für den Mariasteiner Notenbestand durchgeführte aufwändige Recherche über den «Hofmeister’schen Monatsbericht» hat die Bewertung als «historische Quelle» möglich gemacht und zu einer Differenzierung der Massnahmen in der Bestandserhaltung und in der Erschliessung geführt. Die Bewertungsmatrix für die Mariasteiner Musikhandschriften und Notendrucke hat die Schaffung unterschiedlicher Regelwerke zur Erschliessung und verschiedene Erschliessungstiefen bewirkt. 37Sie ist der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der Reorganisation.
Читать дальше