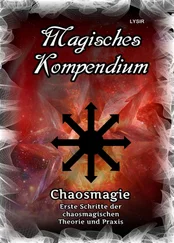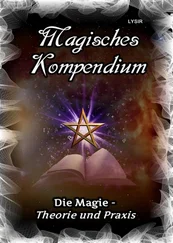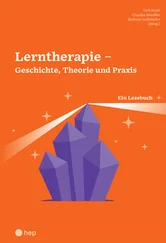Geschichte der Musiksammlung des Benediktinerklosters Mariastein
Die jüngere Geschichte der Mariasteiner Musiksammlung kann als Geschichte des Verlustes bezeichnet werden. Archivalien 4des Klosterarchivs Mariastein und unpublizierte Findmittel der Musiksammlung zeigen auf, dass zwei markante Zäsuren die Sammlung nachhaltig beeinträchtigten, und lassen verstehen, weshalb in der Geschichte der Sammlung die Etablierung eines Bewertungskonzepts bisher nicht möglich war.
Der Catalogus Musici Chori Beinwilensis – das handschriftliche Bestandsverzeichnis der Mariasteiner Musiksammlung aus dem Jahre 1816, erstellt von den Konventualen Trupert Fehr (1784–1820) und Ignaz Stork (1799–1855) – listet in einer ausführlichen bibliographischen Notiz 476 Werke von Klosterkomponisten sowie Quellen anderer musikalischer Zentren auf. Er zeigt auf, dass die Benediktiner von Mariastein zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein reichhaltiges Repertoire pflegten. Aber so reichhaltig das Repertoire im Catalogus auch dokumentiert ist: In der heutigen Überlieferung der Mariasteiner Musiksammlung mit 957 signierten Einheiten (Handschriftenbestand) ist der grösste Teil der bibliographischen Notizen des Catalogus nicht mehr vorhanden. Dies ist umso bemerkenswerter, weil durch Kopistenabschriften und Schenkungen im 19. und 20. Jahrhundert das klösterliche Repertoire sukzessiv zu einem Archivbestand ausgebaut wurde. Für diesen Ausbau stützte sich das Kloster nicht primär auf den Notenkauf ab, sondern auf klostereigene Kopisten, die als Musiker und Komponisten Interesse an einer vielfältigen Musikpflege haben mussten. P. Edmund Kreuzer (1793–1858) und P. Aemilian Gyr (1807–1879) trugen in den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts mit Abschriften der Werke von Joseph Haydn wie beispielsweise dem Oratorium «Die Schöpfung» oder den Streichquartetten op. 8 zu einer ausserordentlich frühen Rezeption der Werke Haydns in Mariastein bei. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es P. Leo Meyer (1822–1906), ehemaliger Konventuale des aufgehobenen Zisterzienserklosters St. Urban, der die Rezeption des europäischen Musikschaffens und somit den Sammlungsaufbau in eine neue Richtung lenkte: Seiner Kopistentätigkeit verdankt die Mariasteiner Musiksammlung Bearbeitungen aus Opern von Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti.
Den grössten Einfluss auf die Musikpflege in Mariastein im 19. Jahrhundert und somit auch auf die Entwicklung der Musiksammlung übte P. Leo Stöcklin (1803–1873) aus, der von 1832 bis 1851 Kapellmeister des Stifts war und von 1867 bis zu seinem Tode dem Kloster als Abt vorstand. Stöcklins eigenes kompositorisches Schaffen war sehr umfangreich; im Professbuch von Mariastein 5sind über 300 Ausgaben musikalischer Werke von Leo Stöcklin aufgelistet. Als Herausgeber der Periodika Recueil de musique pour l’Eglise et l’Ecole (Strasbourg, Noiriel ab 1855) und des Journal de Musique religieuse (Mulhouse, 1860–1864) fanden seine Werke über diesen Vertriebszweig Verbreitung und sind in dieser Form heute in wenigen Exemplaren in der Mariasteiner Musiksammlung überliefert. Durch die Bekanntschaft von Leo Stöcklin mit Julius André (1808–1880), dem Sohn des Verlegers Johann Anton André (1775–1842), erhielt Mariastein seine berühmteste Musikquelle: das Autograph des Kyriefragments in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Julius André hat von seinem Vater nach dessen Tod zusammen mit seinen Geschwistern die Sammlung von Mozart-Autographen geerbt, die Johann Anton André zu Beginn des Jahres 1800 von Mozarts Witwe Constanze Mozart käuflich erworben hatte. 6Julius Andrés Handschrift bestätigt die Echtheit des Autographs: «Ich bezeuge hiermit, dass vorstehende 2 Seiten eigne Handschrift von W. A. Mozart u. seiner Composition ist. / Offenbach a/M. 12. August 1847 / Julius André.» 7
Dass das Mozart-Autograph bis heute Teil der Mariasteiner Musiksammlung ist, darf angesichts der zweiten grossen Zäsur des klösterlichen Lebens als glückliche Fügung angesehen werden. Im September 1874 beschlossen der Solothurner Kantonsrat und die Mehrheit der Bevölkerung die «Reorganisation» der kirchlichen Institutionen St. Ursenstift, St. Leodegar (Schönenwerd) und Mariastein. Die Reorganisation garantierte von Staats wegen die Wallfahrt; für diesen Zweck durften Patres im Kloster zurückbleiben. Das Klostervermögen, der Verkaufserlös und die Klostergebäude wurden dem allgemeinen Schulfonds des Kantons überwiesen. Der Abt und die Mehrzahl der Konventualen wurden am 17. März 1875 aus dem Kloster gewiesen. 8Mit der sogenannten «Reorganisation» ist auch der Verlust von Teilen der Musiksammlung verbunden. Darauf deutet eindrucksvoll das heute überlieferte Œuvre von Abt Leo Stöcklin hin: Nur 49 Handschriften und 20 Drucke von ehemals über 300 Werkausgaben haben die Folgen der «Reorganisation» überstanden.
Die Jahre des Exils des Konvents in Delle (F), Dürrnberg (A), Bregenz (A) und der Tätigkeit im Kollegium Karl Borromäus in Altdorf haben die Mariasteiner Musiksammlung auf unterschiedliche Weise geprägt.
Im ersten Exilort Delle (F) gründete der Konvent die Fanfare du Collège St-Benoît, ein Blasorchester unter der langjährigen Leitung von P. Anselm Rais (1864–1904). Das Musikleben des exilierten Konvents erhält eine spezifische Ausrichtung, die in die Musiksammlung Eingang gefunden hat: Das Repertoire der Fanfare ist in der Sammlung durch handschriftliche Quellen und gedruckte Musikalien vorhanden. Die Überlieferungsform der einzelnen Instrumentalstimmen kann als «patchwork» von Handschrift und Druck bezeichnet werden: Handschriftliche Notation und Ausschnitte aus Drucken wechseln sich stückweise ab.
Die nächste Exilstation des Mariasteiner Konvents in Dürrnberg (Hallein/A) von 1902 bis 1906 hat in der Musiksammlung keine Spuren in Form von handschriftlicher oder gedruckter Überlieferung mit dem Besitzervermerk «Dürrnberg» hinterlassen.
1906 verlegte der Konvent von Mariastein-Dürrnberg seinen Sitz nach Bregenz, wo in mehreren Etappen bis 1916 das St. Gallus-Stift entstand. 1906 übernahmen Patres des Mariasteiner Konvents die Leitung des Kollegiums Karl Borromäus in Altdorf.
In der Musiksammlung sind die Spuren des Wirkens in Bregenz und Altdorf unterschiedlich dokumentiert. Aus Bregenz sind keine Dokumente überliefert, die auf eine systematische Sammlungstätigkeit für Musikalien und deren Erschliessung hinweisen. Das Verzeichnis der an Sonn- und Festtagen aufgeführten Messen, Offertorien, Predigt-Lieder vom 2. September 1915 bis 31. Dezember 1920 9gibt Einblick in eine Kirchenmusikpflege, in der neben dem gregorianischen Choral vorab Messen und geistliche Werke für vier Männerstimmen und Orgel aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Aufführung kamen. Es listet das Datum des Festes, die Messe sowie den Komponisten und die Anzahl der Singstimmen auf, jedoch keinen Verweis auf einen Katalog oder ein Inventar. Die gewaltsame Räumung des St. Gallus-Stifts durch die Gestapo 1941 – der Konvent hatte das Kloster innerhalb von 48 Stunden zu verlassen – und die darauf folgende Beschlagnahmung von Kunstgegenständen haben vermutlich auch Teile des Notenbestands dezimiert. 10Nach der Aufgabe des Stifts 1981 ist der noch übrig gebliebene Notenbestand ohne spezifische Verzeichnung in den Mariasteiner Notenbestand eingegliedert worden. An den einstmals separaten Teilbestand «Bregenz» erinnert auf wenigen Exemplaren der Sammlung der Besitzerstempel «Benediktinerstift S Gallus in Bregenz Oesterreich». Eine eigentliche Definition des Teilbestandes «Bregenz» ist nicht mehr möglich.
Im Gegensatz zu Bregenz ist aus der Tätigkeit der Mariasteiner Konventualen im Kollegium Karl Borromäus in Altdorf eine eigentliche Sammlungstätigkeit hinsichtlich Musikalien belegt. In der Musiksammlung sind drei Inventare vorhanden:
— Verzeichnis der kirchl. Musik/Eigentum des Klosters St. Gallus: Dieses Inventar ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil umfasst Messen für gemischten Chor mit Orgel oder Orchester (Signaturen C 1 bis C 46), der zweite Teil Messen für vierstimmigen Männerchor (Signaturen A 1 bis A 16) und der dritte Teil «Requiem, Motetten, geistl. und welt. Lieder, Sammelwerke» (Signaturen L 1 bis L 12).
Читать дальше