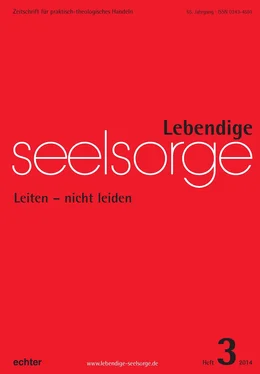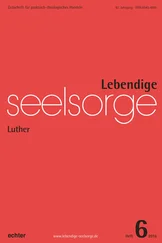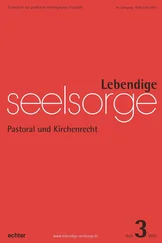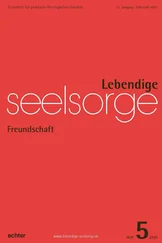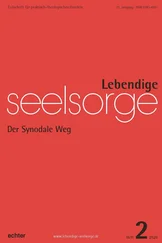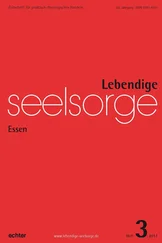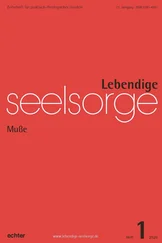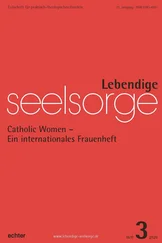LEITEN IN DER ZEITGENÖSSISCHEN DEUTSCHSPRACHIGEN KIRCHE
Historisch sensible Menschen verstehen sich nicht gerne als Herrscher oder Führer. Man spricht stattdessen von Führung oder Leitung. Auch wenn diesbezüglich noch manches ausbaufähig ist, sind auch in der Kirche die Weichen für das Bewusstsein, dass Führung und Leitung professioneller Ausbildung bedürfen, im Wesentlichen gestellt. Zugleich nehme ich eine seltsame Theologie-Ferne wahr: ein wechselseitiger, kritischer Lernprozess zwischen Leitungswissen/-kompetenz und Theologie gehört nicht zur pastoralen Alltagspraxis. Leitungsmethoden werden übernommen, aber selten theologisch reflektiert (vgl. Krobath / Heller 2010; Meier / Sill 2010; Aigner 2011; Kiechle 2010; Zulehner / Rossberg / Hennersperger 2013). Wie wirken sich die Erfahrungen mit Leitungspraxis auf Glaube und Theologie aus? Wie verändern sich dabei auch Inhalte des Glaubens? Wo spießen sich Leitungspraxis und theologische Überzeugungen? Welche Leitungstheorien sind aus theologischer Sicht legitim? [...] Bleiben solche Fragen ausgeklammert, verkommt die Theologie zu einer Art ideologischem Überbau einer „profanen“ Leitungspraxis. Aber gibt es aus der Sicht des Glaubens überhaupt Praxis, die nichts mit Gott und seinem Geist zu tun haben kann? Erst recht eine für die Kirche so zentrale Praxis wie die des Leitens? Sichtbar wird dieser Reflexionsmangel z.B. in den heftigen Debatten um die theologische Würde von Strukturen, die gegenüber „dem Eigentlichen“ nur zweitrangig seien, während manche als sakrosankt gelten. Zudem vertreibt so manche Strukturreform den Geist der Freude, der Hoffnung so heftig aus der Kirche, dass zu viele Gläubige erschöpft und frustriert zurückbleiben.
Neue, individuell erworbene Leitungskompetenzen verändern zudem ohne entsprechende theologische Reflexion nicht von heute auf morgen eine jahrhundertelang eingeübte Praxis im Umgang mit Macht. Leitung bedeutet dann de facto in einer immer noch reichen Kirche Verwaltung des Altbekannten. Leitungspersonen sollen sagen, „wo es langgeht“– nur eben mit mehr Professionalität. Konkret wird dies z.B. dort, wo die Tugend des Gehorsams unverändert als Leitungsinstrument eingesetzt wird – wider jegliches bessere theologische Wissen, dass Gehorsam ein dialogisches Geschehen zwischen Menschen und Gott ist. Konkret wird das dort, wo interner Widerstand und Konflikte nicht als Lernpotential, sondern als Untreue und Illoyalität wahrgenommen werden. Strukturreform und Glaubensvertiefung laufen nebeneinander her. Dabei bieten die Erfahrungen mit zeitgenössischen Leitungstheorien und -praktiken eine Fülle an Impulsen, die den Glauben, die Theologie und damit die Kirche bereichern können. Einige davon möchte ich im Folgenden skizzieren.
VISION UND ZIEL: REICH GOTTES VOR ORT
Wer leitet, braucht eine Vision, eine beschreibbare Vorstellung von der Zukunft. Das gilt auch für jene, die die Kirche leiten. Aber wie kann eine solche Vision für die Kirche aussehen? Aus welchen Quellen speist sie sich? Bei Übungen mit kirchlichen Leitungspersonen bin ich immer wieder mit einem seltsamen Mangel an konkreten Zukunftsbildern konfrontiert. Die Frage: wie sieht die Kirche der Zukunft aus, jener Kirche, die Sie sich wünschen, von der Sie träumen? – sie stößt nicht selten auf Schweigen. Die Bilder erschöpfen sich in Extrapolationen der Gegenwart. Ich höre von neuen Sozialformen oder pastoralen Großräumen. Ja, aber wofür steht diese Kirche? Was ist ihre Aufgabe in dieser konkreten geschichtlichen Stunde? Warum sollte sich ein junger Mensch hier einfinden? Erstickt der Alltagsdruck der Kirchenverwaltung den Mut und die Kraft zum Träumen?
Die Vision des Jesus von Nazareth war das Reich Gottes (Mk 1, 15). Beheimatet in der jüdischen Tradition steht die Erfahrung der Gottesherrschaft im Zentrum seines Lebens. Es wird real in Heilungen und Exorzismen, wo Menschen von Krankheiten und Besessenheiten befreit werden. Es wird konkret in den Mählern Jesu mit Zöllnern, Sündern und Ausgestoßenen; in der bedingungslosen Zusage der Vergebung der Sünden und in der Seligpreisung der Armen. Das Böse ist unwiderruflich entmachtet (Lk 10,18). Das Reich Gottes ist Wirklichkeit und kann nicht aufgehalten werden. Es beschreibt eine persönlich-existenzielle und eine gesellschaftlichpolitische Wirklichkeit, in deren Zentrum die Gerechtigkeit steht ( Eigenmann 1998; vgl. Polak / Jäggle , 603–638).
Die Vision des Jesus von Nazareth kann Quelle und Kriteriologie auch für zeitgenössische Visionen sein. Die Vision der Kirche hat einen besonderen Charakter: sie ist vorgegeben – und bedarf zugleich ihrer zeitgerechten Vergegenwärtigung und Neuübersetzung. Sie beschreibt eine Zukunft, die bereits Gegenwart ist, von Gott her eröffnet. Sie ist Verheißung und Zusage, Hoffnung und Wirklichkeit, Zumutung und Anspruch in einem. Vor allem aber: sie ist kein Privileg von Leitungspersonen, sondern allen Gläubigen anvertraut. Die Vision der Kirche ist daher immer eine geteilte, eine gemeinsam geprüfte und entwickelte. Wäre charismatischen Visionären daher nicht immer mit etwas Vorsicht zu begegnen? „Das Geheimnis der heiligen Kirche wird in ihrer Gründung offenbar. Denn der Herr Jesus machte den Anfang seiner Kirche, indem er frohe Botschaft verkündigte, die Ankunft nämlich des Reiches Gottes, das von alters her in den Schriften verheißen war“ ( LG 5). Daher hat die Kirche die Aufgabe, dieses Reich „anzukündigen und in allen Völkern zu begründen“. Leitung bedeutet, die Gläubigen und die Kirche bei der Wahrnehmung und Verwirklichung der Vision vom Reich Gottes zu begleiten und zu unterstützen. Weil sich das Reich Gottes geschichtlich und konkret offenbart, wird Leitungspraxis in jeder Situation, an jedem Ort verschieden aussehen.
Um eine Vision des Reiches Gottes vor Ort gemeinsam zu entwickeln, braucht es entsprechende Kommunikations- und Lernprozesse. Leitung initiiert, gestaltet und begleitet solche Prozesse. Auch und gerade innerhalb dieser Prozesse kann sich Reich Gottes realisieren. Theologisch lassen sich solche Prozesse als „Weg“ verstehen. Auf diesem Weg wird wie in der Apostelgeschichte gebetet und gefeiert, werden Gemeinden gegründet und wieder aufgelassen, engagieren sich ChristInnen in der Welt. Der Weg führt durch die konkrete Geschichte. Es gibt Irrwege, Abwege, Umwege – und in jedem Fall begegnet man unterwegs anderen Menschen. Sind Prozesse innerhalb der Kirche, an denen sich nur die Zugehörigen beteiligen, daher nicht eine Verzerrung des christlichen Weges? Müssen die „Anderen“ der Kirche nicht notwendig Teil jedes kirchlichen (Reform)Prozesses sein? Die Reich-Gottes-Vision bezieht sich ja auf die Menschheit, die Kirche ist „nur“ Zeichen und Werkzeug auf dem Weg dorthin ( LG 1).
Leitung begleitet den Weg der Gläubigen inmitten der Geschichte. Der gemeinsamen Identifikation der „Zeichen der Zeit“ kommt dabei eine besondere Relevanz zu: sie lassen jene konkreten Aufgaben erkennen, die Gott der Kirche stellt. Dies geschieht gemeinsam mit jenen, die auf diesem Weg unterwegs sind und mit jenen, denen man unterwegs begegnet (vgl. Ruggieri , 61–70). Benötigt dafür nicht jede Leitungsperson in der Kirche Erfahrungen mit der Welt jenseits der Kirche? (vgl. dazu GS 44). Unternehmen achten heute bei Bewerbern darauf, ob sie Erfahrungen nachweisen können, die nichts mit Ausbildung und Geldverdienen zu tun haben.
MITTEL UND INSTRUMENTE: FÖRDERN SIE BEZIEHUNG UND KOMMUNIKATION, PARTIZIPATION UND LERNPROZESSE?
Einige Fragen, die helfen können, die Qualität der eingesetzten Leitungs-Tools theologisch zu reflektieren:
Читать дальше