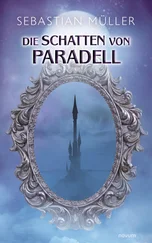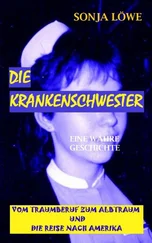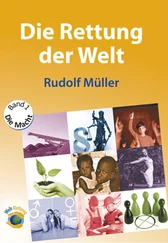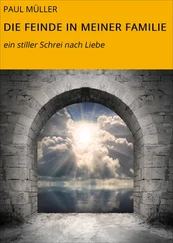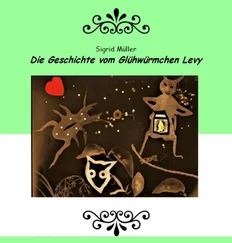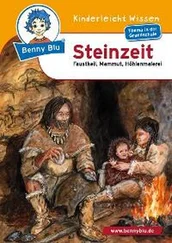In einem selbständigen Satz (vgl. (28)) beinhaltet C 0das finite Verb, das sich von I 0weiterbewegt. In einem V1-SatzVerberst-Satz ist SpecCP leer, in einem V2-SatzVerbzweit-Satz beinhaltet SpecCP eine Konstituente, die aus ihrer Basisposition in diese Position vorangestellt wird.

 Im Gegensatz zu N, A, V und P, den lexikalischen KategorienLexikalische Kategorie, handelt es sich bei I und C um funktionale KategorienFunktionale Kategorie. Sie weisen weniger semantisch fassbaren Inhalt auf, wie man ihn Nomen, Adjektiven, Verben oder Präpositionen (bzw. ihren Phrasen) mehr oder weniger einfach zuschreiben kann, sondern sie erfüllen eine Aufgabe der Grammatik.
Im Gegensatz zu N, A, V und P, den lexikalischen KategorienLexikalische Kategorie, handelt es sich bei I und C um funktionale KategorienFunktionale Kategorie. Sie weisen weniger semantisch fassbaren Inhalt auf, wie man ihn Nomen, Adjektiven, Verben oder Präpositionen (bzw. ihren Phrasen) mehr oder weniger einfach zuschreiben kann, sondern sie erfüllen eine Aufgabe der Grammatik.
Oben haben wir gesehen, dass die Finitheit in I 0verankert wird und in dieser Phrase die Nominativzuweisung an das Subjekt erfolgt bzw. die Kongruenz zwischen dem Subjekt und dem finiten Verb hergestellt wird. Innerhalb der CP wiederum entscheidet sich, ob ein selbständiger oder unselbständiger Satz vorliegt und um welchen Satztyp es sich handelt.
Man kann die Positionen des CP/IP-ModellsCP/IP-Modell auf die Felder des Topologischen FeldermodellsTopologisches Feldermodell beziehen. Das Vorfeld entspricht dabei SpecCP, die linke Satzklammer (LSK) wird C 0zugeordnet und die rechte Satzklammer (RSK) entspricht I 0. Unter dieser Sicht werden keine weiteren Operationen benötigt, als die drei, die wir bereits kennengelernt haben. Lediglich die Finitumvoranstellung muss etwas erweitert werden. Die TopikalisierungTopikalisierung hat als Ziel SpecCP, bei der FinitumvoranstellungFinitumvoranstellung wird das Verb nicht nur von I 0nach C 0bewegt, sondern es wird von V 0über I 0zu C 0angehoben. Für unsere Darstellung vom Anfang würde dies bedeuten, dass das Verb zunächst unflektiert im MittelfeldMittelfeld steht und in die RSK bewegt wird, um flektiert zu werden, bevor es in die LSK vorangestellt wird.
Wenn I 0der RSK entspricht, fehlt in der Repräsentation in (28) noch das NachfeldNachfeld. Man hat hier angenommen, dass per AdjunktionAdjunktion an die IP eine Position erzeugt wird, in die extraponierte Konstituenten bewegt werden (vgl. (29)).

Ein weiteres funktionales Element ist der D-Kopf, der eine DP projiziert (vgl. Abney 1987, für eine Zusammenfassung vgl. Philippi & Tewes 2010: 115ff.). Wie I 0beinhaltet dieser Kopf grammatische Merkmale. Die für D relevanten Merkmale sind DefinitheitDefinitheit und SpezifizitätSpezifizität.
 Definitheit hat mit Bekanntheit zu tun. Tritt ein indefiniter ArtikelIndefiniter Artikel auf (vgl. (30a)), ist der Referent der NP i.d.R. in der Diskurssituation noch nicht bekannt. Wird ein definiter ArtikelDefiniter Artikel verwendet, ist der NP-Referent bereits in den Diskurs eingeführt worden (vgl. (30b)).
Definitheit hat mit Bekanntheit zu tun. Tritt ein indefiniter ArtikelIndefiniter Artikel auf (vgl. (30a)), ist der Referent der NP i.d.R. in der Diskurssituation noch nicht bekannt. Wird ein definiter ArtikelDefiniter Artikel verwendet, ist der NP-Referent bereits in den Diskurs eingeführt worden (vgl. (30b)).
| (30) |
a. |
EinMann lacht. |
|
b. |
DerMann lacht. |
Spezifizität bezieht sich auf die Identifizierbarkeit eines Referenten, d.h. ob man sich mit der NP auf einen bestimmtenReferenten bezieht. Unter der unspezifischen LesartUnspezifische Interpretation bedeutet der Satz in (31), dass der Dirigent irgendeineweibliche Person sucht, die Geige spielt. Unter der spezifischen LesartSpezifische Interpretation sucht der Dirigent eine bestimmteGeigerin.
| (31) |
Der Dirigent sucht eine Geigerin. |
Syntaktisch nimmt man eine DeterminiererphraseDeterminiererphrase (DP) an. Im Englischen bezeichnet man Ausdrücke wie ArtikelArtikel ( ein , der ), PossessivPossessivpronomen -( sein ) und DeterminativpronomenDeterminativpronomen ( dieser ) als determinerDeterminer. D 0ist der Kopf dieser Phrase, sein Komplement ist eine NP. Die Struktur sieht aus wie in (32).

Wir können eine Phrase wie der Mann nun als NP wie in (33) oder als DP wie in (34) analysieren.

SpecDP ist z.B. besetzt, wenn ein pränominaler Genitiv auftritt, wie in (35).

D 0kann auch leer bleiben. Dies ist beispielsweise bei Eigennamen der Fall (vgl. (36)).

1.1.3 Grundannahmen des Grammatikmodells
Das bis hierher entworfene Bild entspricht dem Modell der Rektions- und BindungstheorieRektions- und Bindungstheorie (Chomsky 1981), das als T-ModellT-Modell bezeichnet wird, weil es wie ein umgedrehtes T aussieht (vgl. (37)).

Dieser Vorstellung nach entstammen die Wörter, die Bestandteil eines Satzes sind, dem mentalen LexikonMentales Lexikon. Wörter weisen einen LexikoneintragLexikoneintrag auf, dem neben phonologischer und semantischer Information auch Informationen zur ValenzValenz, d.h. zur Argumentstruktur,Argumentstruktur zu entnehmen sind. Das heißt, von einem Verb wie kaufen wissen wir z.B., dass es zwei Argumente hat, eine NP im Nominativ und eine NP im Akkusativ. Ebenfalls wissen wir, dass die erste NP interpretatorisch ein Handelnder ist ( AgensAgens) (anders als diese NP im Falle von erhalten ( EmpfängerEmpfänger) ( Peter erhält einen Brief. ) oder profitieren ( BenefizientBenefizient) ( Peter profitiert von Marias Monatskarte für die Straßenbahn. )). Die NP im Akkusativ wird im Fall von kaufen als das, womit etwas gemacht wird, verstanden ( ThemaThema) (im Gegensatz zur Akkusativ-NP bei benutzen ( InstrumentInstrument) ( Hans benutzte ein Messer. ) oder erreichen ( ZielZiel) ( Hans erreichte das Ziel. )). Diese inhaltlichen Füllungen der Argumentstellen werden als thematische RollenThematische Rolle ( θ-Rollen) bezeichnet. (38) zeigt einen Lexikoneintrag für den Verbstamm weck -.
Читать дальше
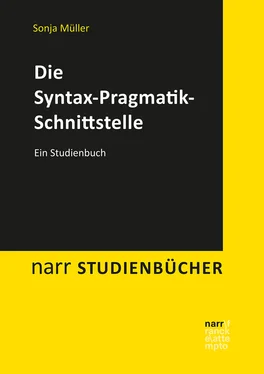


 Im Gegensatz zu N, A, V und P, den lexikalischen KategorienLexikalische Kategorie, handelt es sich bei I und C um funktionale KategorienFunktionale Kategorie. Sie weisen weniger semantisch fassbaren Inhalt auf, wie man ihn Nomen, Adjektiven, Verben oder Präpositionen (bzw. ihren Phrasen) mehr oder weniger einfach zuschreiben kann, sondern sie erfüllen eine Aufgabe der Grammatik.
Im Gegensatz zu N, A, V und P, den lexikalischen KategorienLexikalische Kategorie, handelt es sich bei I und C um funktionale KategorienFunktionale Kategorie. Sie weisen weniger semantisch fassbaren Inhalt auf, wie man ihn Nomen, Adjektiven, Verben oder Präpositionen (bzw. ihren Phrasen) mehr oder weniger einfach zuschreiben kann, sondern sie erfüllen eine Aufgabe der Grammatik.