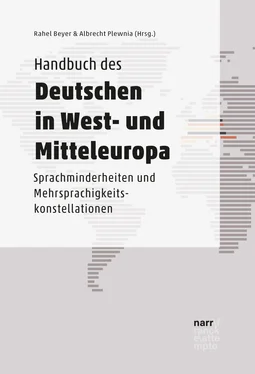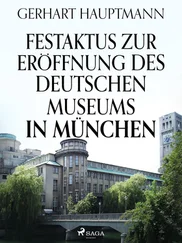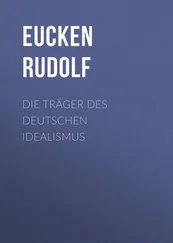Bourdieu, Pierre (1982): Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard.
Brüll, Christoph (2009): L’identité des Belges germanophones est une non-identité. Quelques réflexions à propos de publications récentes sur l’histoire de la Communauté germanophone de Belgique. In: Cahiers d’Histoire du Temps Présent, 21, S. 211–226.
Geschichtsverein „Zwischen Venn und Schneifel“ (Hrg.) (1969): Kriegsschicksale 1944–45. Beiträge zur Chronik der Ardennenoffensive zwischen Venn und Schneifel. St. Vith: Geschichtsverein „Zwischen Venn und Schneifel“.
Gorter, Durk et al. (Hrg.) (2012): Minority Languages in the Linguistic Landscape. New York u.a.: Palgrave Macmillan.
GrenzEcho-Redaktion (2006): Belgien 1830–2005. Deutschsprachige Gemeinschaft 1980–2005. Eupen: Grenz-Echo.
Greten, Verena (2008): Unterricht und Ausbildung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Eupen (= Schriftenreihe des Ministeriums der DG; 3). Abrufbar unter: http://www.ostbelgienbildung.be/PortalData/21/Resources/downloads/home/publikationen/WEB_Band3-2Auflage.pdf. (Letzter Zugriff 29.11.2018).
Hecking, Anton (1875/ 21977): Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft St. Vith. Brüssel: Éditions Culture et Civilisation.
Heinen, Franz-Josef/Kremer, Edie (2011): Mostert, Bics und Beinchen stellen. Alltagssprache in Ostbelgien. Eupen: Grenz-Echo.
Henkes, André (2012): Die (Weiter)Entwicklung der deutschen Rechtssprache in Belgien. Online-Dokument. Abrufbar unter: http://www.ostbelgienrecht.be/Portal-Data/30/Resources/dokumente/Henkes_-_Die_Entwicklung_einer_deut-schen_Rechtssprache_in_Belgien.pdf. (Letzter Zugriff 29.11.2018).
Jenniges, Hubert (2001): Hinter ostbelgischen Kulissen. Stationen auf dem Weg zur Autonomie des deutschen Sprachgebiets in Belgien (1968–1972). Eupen: Grenz-Echo.
Kartheuser, Bruno (2001): Die 30er Jahre in Eupen-Malmedy. Einblick in das Netzwerk der reichsdeutschen Subversion. Neundorf: Krautgarten Orte.
Kern, Rudolf (1999): Beiträge zur Stellung der deutschen Sprache in Belgien. Louvain-la-Neuve: Collège Érasme/Bureau du Recueil u.a. (= Recueil de Travaux d’Histoire et de Philologie; Sér. 7, 9).
Lejeune, Carlo (2005): Die Säuberung. Bd. 1: Ernüchterung, Befreiung, Ungewissheit (1920–1944). Büllingen: Lexis-Verlag (= ZVS-Reihe: Auf dem Weg zur Deutschsprachigen Gemeinschaft).
Maxence, Pierre (1951): Les Atouts gaspillés ou le drame des Cantons de l’Est. St. Niklaas: Jos. D’Hondt.
Minke, Alfred (1995): Entre deux mondes: les „Cantons de l’Est“. In: La Revue Générale, 10, S. 17–24.
Michel, Henri (1985): Oranienburg-Sachsenhausen. KZ-Erinnerungen und Hungermarsch in die Freiheit eines politischen Gefangenen. Eupen: Grenz-Echo.
Nelde, Peter (1979): Volkssprache und Kultursprache. Die gegenwärtige Lage des sprachlichen Übergangsgebietes im deutsch-belgisch-luxemburgischen Grenzraum. Wiesbaden: Steiner (= Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik: Beihefte; 31).
Neumann, Uta (2016): König Philippe hat nach Ostbelgien eingeladen. Abrufbar unter: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.deutsch/nachrichten/1.2761726#. (Letzter Zugriff 6.11.2018).
Pabst, Klaus (1964): Eupen-Malmedy in der belgischen Regierungs- und Parteienpolitik 1914–1940. In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 76, S. 206–514.
Rosensträter, Heinrich (1985): Deutschsprachige Belgier. Geschichte und Gegenwart der deutsche Sprachgruppe in Belgien. 3 Bde. Aachen: Selbstverlag.
Schmitz-Reiners, Marion (2006): Belgien für Deutsche. Einblicke in ein unauffälliges Land. Berlin: Links Christoph Verlag.
Senster, Corina (2010): Das Bildungswesen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und ein Konzept der Mehrsprachigkeit. Powerpoint. Eupen. Abrufbar unter: http://www.rml2future.eu/NR/rdonlyres/7D142316-BC21-4DBA-84F7-6A01D76EAA6F/0/BildungswesenDGBelgienSenster.pdf. (Letzter Zugriff 24.10.2018).
Sereni, Sabrina (2008): Lehr- und Lernbedingungen in der Primarschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. In: Bos Wilfried/Sereni, Sabrina/Stubbe, Tobias (Hrg.): S. 41–51.
Stangherlin, Katrin (Hrg.) (2005): La Communauté germanophone de Belgique – Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Coll. Projucit. Bruges: La Charte.
Stedje, Astrid (2007): Deutsche Sprache gestern und heute. 6.Aufl. Paderborn: Wilhelm Fink.
Verhiest, Glenn (2015): Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens als visuelle Sprachlandschaft. In: Germanistische Mitteilungen. Zeitschrift für Deutsche Sprache, Literatur und Kultur, 41.2, S. 51–72.
Willems, Bernhard (Hrg.) (1948–1949): Ostbelgische Chronik. Bd. I 1948, Bd. II 1949. Selbstverlag.
Witte, Els (2005): De constructie van België. In: Witte, Els/Gubin, Eliane/Nandrin, Pierre/Deneckere, Gita (Hrg.): Nieuwe geschiedenis van België. Tielt: Lannoo, S. 29–230.
Mélanie Wagner
1 Geographische Lage
2 Demographie und Statistik
3 Geschichte
4 Wirtschaft, Politik, Kultur und rechtliche Stellung
4.1 Wirtschaftliche Situation
4.2 Politische Situation
4.3 Offizielle Sprachregelungen
4.4 Schulsystem
4.5 Medien, Literatur, Werbung
5 Soziolinguistische Situation
5.1 Kontaktsprachen
5.2 Die einzelnen Sprachformen des Deutschen
6 Sprachgebrauch und -kompetenz
6.1 Einschätzung der Sprachkompetenz in den verschiedenen Sprachen/Varietäten
6.2 Kommunikationssituationen des Deutschen
7 Spracheinstellungen
8 Linguistic Landscape
9 Faktorenspezifik
Literatur
Mit einer Einwohnerzahl von 590.700 (Statec 2017: 12) und einer geographischen Fläche von 2.586 km ²liegt Luxemburg zwischen den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Belgien. Das GroßherzogtumLuxemburg ist ein Staat und eine Demokratiein Form einer konstitutionellen Monarchie(Thewes 2018) im Westen Mitteleuropas. Luxemburg ist das letzte Großherzogtum in Europa: Seit dem 7. Oktober 2000 ist Henri von Nassau Großherzog des Landes. Nationalspracheist Luxemburgisch, Verwaltungs-und Amtssprachensind Luxemburgisch, Französischund Deutsch. Gemeinsam mit Belgienund den Niederlanden bildet Luxemburg die Beneluxstaaten; es ist außerdem eines der sechs Gründungsmitglieder der Europäischen Union.
Luxemburg grenzt im Süden über 73 km an Frankreich, im Westen über 148 km an Belgienund im Osten über 135 km an Deutschland. Der Norden des Landes ist ein Teil der Ardennenund wird (das) Öslinggenannt. Dieser Teil liegt auf durchschnittlich 400 bis 500 m über dem Meeresspiegel. Die Landschaft im Ösling ist geprägt von bewaldeten Bergen, Hügeln und tiefen Flusstälern, zum Beispiel dem Sauertal. Im Süden liegt das fruchtbare Gutland, das zum Lothringer Stufenlandgehört. Dieses Gebiet weist eine höhere Bevölkerungs- und Industriedichte als das Ösling auf. Entwässert wird das Land durch die west-östlich verlaufende Sauer, die Klerfund die Ourim Norden und die Alzetteim Süden. Der niedrigste Punkt des Landes, Spatz genannt (129 m), befindet sich am Zusammenfluss von Sauer und Moselin Wasserbillig. Wichtige Flüsse Luxemburgs sind die Mosel, die im Südosten den Grenzfluss zu Deutschlandbildet, die Sauer, die Ourund die Alzette.
2 Demographie und Statistik
In Luxemburg leben laut den letzten Zählungen aus dem Nationalregister am 1. Januar 2017 590.700 Personen (Statec 2017: 12). Ihre Nationalitäten setzen sich folgendermaßen zusammen:
| Luxemburger |
309.200 |
| Ausländer |
281.500 |
| Davon: |
Portugiesen |
96.800 |
|
Franzosen |
44.300 |
|
Italiener |
21.300 |
|
Belgier |
20.000 |
|
Deutsche |
13.100 |
|
Briten |
6.100 |
|
Niederländer |
4.300 |
|
Sonstige EU-Länder |
34.400 |
|
Sonstige |
41.200 |
| Ausländer in % |
47,7 % |
Tab. 1:
Читать дальше