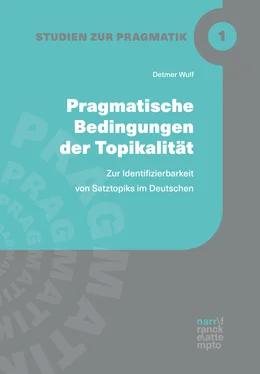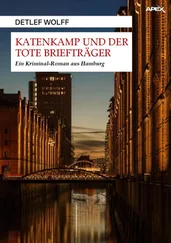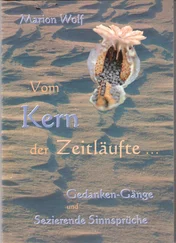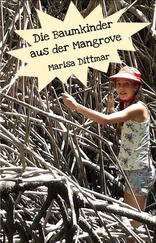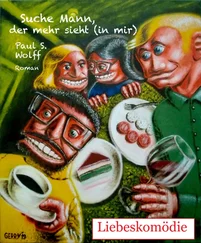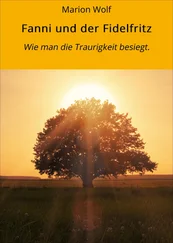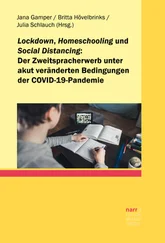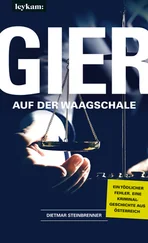1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Bestimmt man nun den CD-Grad von Satzelementen auf der Basis der Rolle der DSFs als kommunikationseröffnend oder kommunikationsabschließend unabhängig vom Kriterium der Zugänglichkeit, so sind kommunikationseröffnende Subjekte in Bearer-Funktion und adverbiale Set-Elemente in dieser Hinsicht unproblematisch. Sie können sowohl kontextabhängig als auch kontextunabhängig sein. Sp-Elemente, Ph-Elemente sowie die verbalen Q- und Pr-Elemente sind aufgrund ihrer generellen Kontextunabhängigkeit ebenfalls unproblematisch. Lediglich die kontextabhängigen Satzelemente in Objektposition entziehen sich der relationalen Perspektive. Bei ihnen leitet sich die DSF nicht aus dem Bezug zu den DSFs der anderen Mitspieler im Satz ab, sondern allein aus ihrer Zugänglichkeit im unmittelbar relevanten Kontext. Die Folge ist, dass die Bestimmung ihrer DSF eher stipulativen Charakter hat. Derartige Fälle seien, so heißt es in Firbas (1992), „context-dependent elements that have acquired the Set-status through context dependence“ (s.o.).
Firbas’ Begriff des kommunikativen Dynamismus weist somit zwei Dimensionen auf, die er in einem integralen Konzept vereinen möchte: Zum einen die referentielle Dimension, innerhalb der das Kriterium der Zugänglichkeit im unmittelbar relevanten Kontext maßgeblich ist. Hieraus ergibt sich die Bestimmung der Satzelemente als kontextabhängig oder kontextunabhängig, wobei gilt, dass nur kontextunabhängige Elemente die Kommunikation im Firbas’schen Sinne abschließen können. Zum anderen die relationale Dimension, innerhalb der die kommunikative Perspektive des Satzes aus den dynamisch-semantischen Funktionen seiner Elemente abgeleitet wird. In relationaler Hinsicht ergibt sich aus den dynamisch-semantischen Rollen der Satzelemente der spezifische Charakter der jeweiligen Satzperspektive: entweder im Sinne der Spezifizierung einer bestimmten Qualität oder im Sinne der Präsentation eines Gegenstands in einem Setting. Im CD-Grad möchte Firbas beide Dimensionen zu einem integralen Wert zusammenfassen: In ihm drückt sich dann der Beitrag eines Satzelements zum Fortgang des Kommunikationsprozesses aus. Beide Dimensionen lassen sich aber offensichtlich nicht bruchlos aufeinander beziehen, was nicht ohne Folgen für die Bestimmung des Thema-Begriffs bleibt: Thematizität wird damit zum Teil referentiell, zum Teil relational expliziert.
Auch was den so oft herausgestellten graduellen Charakter des kommunikativen Dynamismus betrifft, so muss dieser m.E. relativiert werden. Firbas löst sich in seinem Ansatz durchaus nicht von dichotomischen Konzepten. Dichotomien bilden die Grundlage sowohl für die referentielle als auch für die relationale Dimension. In referentieller Hinsicht ist die Unterscheidung von kontextabhängigen und kontextunabhängigen Elementen grundlegend, in relationaler Hinsicht die Unterteilung des Satzes in „foundation-laying“ und „core-constituting elements“.
Ein Ausweg aus der offensichtlich inkonsistenten Zusammenführung der relationalen und referentiellen Dimension bestünde möglicherweise darin, beide Ebenen kategorial voneinander zu trennen. Einen solchen Weg beschreitet Halliday, der zwischen Thematizität und Givenness unterscheidet.
2.4 Halliday: Theme vs. Given
Wie wir gesehen haben, umfasst die Thema/Rhema-Dichotomie, so wie sie im Rahmen der Prager Schule zunächst von Mathesius ausformuliert wurde, zwei Aspekte der Informationsstrukturierung: einerseits die Unterscheidung von bekannter und neuer Information (given-new), andererseits die Gegenüberstellung von Satzgegenstand und Satzaussage. Auch Firbas versucht, wie gezeigt wurde, zwei Aspekte in ein einheitliches Konzept zu integrieren. Die mit der given-new-Dichotomie verwandte Unterscheidung kontextabhängiger und kontextunabhängiger Satzelemente und die eher auf den Mitteilungsaspekt abzielende, aber durchaus mit der Unterscheidung von Satzgegenstand und Satzaussage verwandte Aufteilung des Satzes in „foundation-laying“ und „core-constituting elements“ vereint Firbas in seinem Konzept des kommunikativen Dynamismus. M.A.K. Halliday, der im Rahmen seines funktionalen Grammatikkonzepts ebenfalls mit Kategorien der Informationsstruktur operiert, schlägt einen anderen Weg ein (vgl. Halliday 1967, 1970, 1985). Halliday unterscheidet begrifflich zwischen ‚Thema vs. Rhema‘ und ‚given vs. new‘. Obwohl er beide Dichotomien der „textuellen“ Funktion ‚Theme‘ zuordnet,1 plädiert er für eine kategoriale Trennung. Beides falle zwar häufig, jedoch nicht notwendig zusammen (vgl. Halliday 1970, 162).
Die Thema/Rhema-Dichotomie bestimmt Halliday im Sinne der Unterscheidung von Satzgegenstand und Satzaussage. Ein Satz in seiner Funktion als Mitteilung („message“) lässt sich zerlegen in den satzinitialen thematischen Bereich und den daran anschließenden rhematischen Bereich, wobei das Thema als „point of departure“ (1985, 38) fungiert: „[…] the Theme is the starting-point of the message; it is what the clause is going to be about“ (ebd., 39).2 Thematisch in diesem Sinne können nach Halliday neben einfachen und komplexen Nominalphrasen in Subjektposition und satzinitialen adverbialen Ergänzungen auch die Vorfeld-Elemente von Cleft-Sätzen sein. Vgl. Halliday (1970, 161) und (1985, 60):
| Theme |
Rheme |
| I |
don’t know. |
| People who live in glasshouses |
shouldn’t throw stones. |
| Yesterday |
we discussed the financial arrangements. |
| It was his teacher |
who persuaded him to continue. |
Die Thema/Rhema-Struktur grenzt Halliday ab von der Ebene der ‚Informationsstruktur‘, die er funktional der given/new-Dichotomie zuordnet. Dabei nimmt er die Unterscheidung von ‚aboutness‘ und ‚givenness‘ nicht nur in funktionaler Hinsicht vor, sondern auch hinsichtlich der Mittel ihrer sprachlichen Signalisierung (vgl. 1970, 160f.): Die Thema/Rhema-Struktur wird über die Wortstellung realisiert, wobei Halliday für das Englische die strikte Regel formuliert, dass das Thema die satzinitiale Position einnimmt (siehe die o.a. Beispiele), wohingegen die Informationsstruktur durch Intonation ausgedrückt wird, indem ‚neue‘ Elemente durch Akzentuierung markiert werden.
Eine Konsequenz dieser strikten Bestimmung ist, dass Halliday auch die satzinitialen Elemente in Frage- und Imperativsätzen als thematisch bestimmen muss. So versucht Halliday die Thematizität des Fragepronomens oder des finiten Verbs als Erstelemente im Fragemodus mit Bezug auf seine Themabestimmung als das, „what the sentence is about“ zu rechtfertigen: „The natural theme of a question […] is ‘what I want to know’“ (1985, 47).3
Um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, Thematizität allein an topologischen Kriterien festzumachen, unterscheidet Halliday zwischen Realisierung und Funktion: „First position in the clause is not what defines the Theme; it is the means whereby the function of Theme is realized , in the grammar of English“ (1985, 39). Halliday betont zwar ausdrücklich, dass er die strikte Erstposition nur für das Englische behauptet, die satzinitiale Position des Themas hat für ihn letztlich aber doch universalen Charakter:
[…] if in any given language the message is organized in Theme-Rheme structure, and if this structure is expressed by the sequence in which the elements occur in the clause, then it seems natural that the position for the Theme should be at the beginning, rather than at the end or at some other specific point. (Halliday 1985, 39)
Die kategoriale Trennung von Thema/Rhema-Struktur und informationeller Struktur beruht jedoch nicht nur auf ihren unterschiedlichen Funktionen und den jeweils spezifischen Mitteln ihrer Signalisierung (Theme/Rheme: Wortstellung; Given/ New: Intonation), sondern auch auf dem Umstand, dass sich die Kategorien auf unterschiedliche Einheiten beziehen. Während Thema und Rhema (einfachen oder komplexen) Konstituenten des Satzes entsprechen, ordnet Halliday ‚given‘ und ‚new‘ sogenannten ‚Informationseinheiten‘ („information units“) zu:
Читать дальше