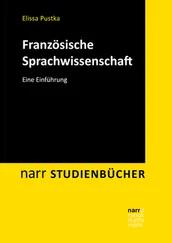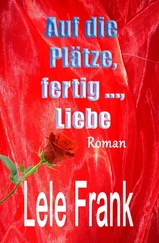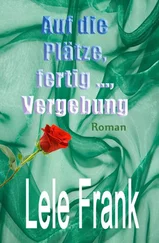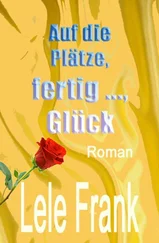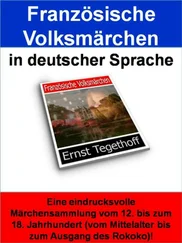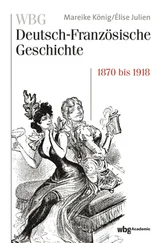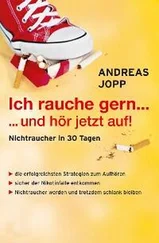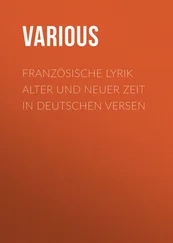Die letzten Monographien zur gesamten französischen Sprachgeschichte oder einzelnen Epochen, die aktuell erschienen sind, stellen im Wesentlichen Neuauflagen älterer Editionen dar, wie beispielsweise Cerquiglini (2013), Klare (2011), Berschin/Felixberger/Goebl (2008), Zink (2007) oder Picoche/Marchello-Nizia (2001). Relativ neu hingegen ist die neu aufgelegte Zusammenschau von Huchon (2016) sowie die kurzen Übersichten zum Alt- und Mittelfranzösischen von Ducos/Soutet (2012) und Duval (2009). Die lautliche Entwicklung und die Morphologie des Altfranzösischen finden sich in den beiden Neuauflagen von Joly (2004, 2009); die zahlreichen reinen Lehrbücher zum Altfranzösischen seien hier nicht berücksichtigt. Maßgeblich sind entsprechend dem allgemeinen Trend in den historischen Wissenschaften größere Kompendien mit einer Sammlung von Einzeldarstellungen. Ein solches Werk wie es beispielsweise für das Spanische mit der Sprachgeschichte von Cano Aguilar (2005) oder für das Italienische mit der mehrbändigen Sprachgeschichte von Serianni/Trifone (1993–1994) erschien, liegt, wenn auch nicht so differenziert wie letzteres, für das Französische mit der Neuauflage von Chaurand (2012) vor. Die umfangreichste Darstellung der französischen Sprachgeschichte bleibt jedoch nach wie vor die von Brunot (1905–1938).5 Was die aktuelle Forschung anbelangt ist zudem vor allem auf die einzelnen einschlägigen Artikel der dreibändigen Romanischen Sprachgeschichte von Ernst/Gleßgen/Schmitt/Schweickard (2003–2008) aus der HSK -Reihe zu verweisen, auf die wenigen historisch ausgerichteten kurzen Beiträge aus dem Handbuch Französisch von Kolboom/Kotschi/Reichel (2008) sowie ganz aktuell auf die entsprechenden Einzeldarstellungen aus dem Manuel de linguistique française von Polzin-Haumann/Schweickard (2015). Ergänzend dazu können auch die entsprechenden historischen Artikel aus dem zu den Fach- und Gruppensprachen vorliegenden Manuel von Forner/Thörle (2016) herangezogen werden, aus dem zur Editionsphilologie von Trotter (2015) und aus dem zur francophonie von Reutner (2017), alle aus der neugegründeten MRL -Reihe.
Zuletzt sei noch auf einige Wörterbuchprojekte hingewiesen, die entweder kürzlich abgeschlossen wurden oder die sich noch in Arbeit befinden, sowie auf damit zusammenhängende und weitere Digitalisierungs- und Datenbankprojekte. Es stehen mit Greimas (2012) zum Altfranzösischen und Greimas/Keane (2007) zum Mittelfranzösischen zwei aktuelle je einbändige Wörterbücher zur Verfügung, die ergänzt werden durch die überarbeiteten etymologischen Wörterbücher von Picoche (2015) und von Dubois/Mitterand/ Dauzat (2011) sowie durch das mehrbändige zur Wortgeschichte von Rey (2016), dessen aktuellste und erweiterte Auflage gerade erschienen ist. Im Wörterbuch von Enckell (2017) wird die historische Schichtung des français non conventionnel dargestellt. Das über mehrere Jahrzehnte entstandene Französische Etymologische Wörterbuch (FEW) von Walther von Wartburg (1922–2002), welches 2002 einen vorläufigen Abschluss gefunden hatte, wird zur Zeit in Nancy (ATILF/CNRS/Université de Lorraine) weiterverfolgt und dort digitalisiert (bisher nur images ) – weitere Faszikel sind zumindest in Planung. Noch im Entstehen begriffen ist das Dictionnaire étymologique de l’ancien français (DEAF), welches von Kurt Baldinger begründet wurde und nun von Frankwalt Möhren in Heidelberg weitergeführt wird, zudem gleichzeitig als DEAF él digitalisiert wird. Ebenfalls noch im statu nascendi sind die beiden Wörterbuchprojekte zum Okzitanischen, das DAO und das DAG, die in München respektive Heidelberg fortgeführt werden. An der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist unter der Leitung von Martin-Dietrich Gleßgen auch die Digitalisierung des gaskognischen Wörterbuchs realisiert worden (DAG él ). Digitalisiert und mit einer Suchfunktion versehen wurde das nun schon betagte, aber nichtsdestoweniger immer noch dienliche Wörterbuch zum Altfranzösischen von Godefroy (1881–1902), das von Classiques Garnier in Paris gehosted wird, sowie das an der Universität in Stuttgart angesiedelte von Tobler/Lommatsch (1925–2002), beide nach wie vor unverzichtbare Referenzen. Zwar nicht grundsätzlich historisch ausgerichtet aber mit knapper und valider etymologischer Referenz versehen ist die Online-Version des TLF, die in Form des TLFi in Nancy (ATILF/CNRS/Université de Lorraine) verortet ist. Dort ist zudem das elektronische Wörterbuch DMF zum Mittelfranzösischen angesiedelt sowie das Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes (DÉCT), welches sich aus den Dichtungen Érec , Cligès , Lancelot , Yvain und Perceval speist, sowie das gesamtromanische etymologische Wörterbuch DÉRom unter der Leitung von Wolfgang Schweickard (Saarbrücken) und Éva Buchi (CNRS/ATILF). Ein spezifisches Wörterbuch ist das Anglo-Norman-Dictionary (AND), das 2005 neu aufgelegt wurde und zusätzlich nun an den Universitäten von Aberystwyth und Swansea nach und nach digitalisiert wird ( Anglo-Norman Online-Hub ). Ebenfalls historisch spezifisch sind die in Bamberg angesiedelten etymologischen Wörterbuchprojekte zum französischen Kreol von Annegret Bollée (als Ergänzung des FEW gedacht), das DECOI (1993–2007) und das DECA (2017–2018). Nicht diatopisch, sondern fachsprachlich orientiert sind die Wörterbuchprojekte DFSM (Paris) zur mittelalterlichen Wissenschaftssprache des Französischen und DiTMAO (Göttingen) zum medizinisch-botanischen Fachwortschatz des Okzitanischen. Einem grammatischen Phänomen widmet sich das Grazer Projekt des Dictionnaire historique de l’adjectif-adverbe (DHAA).
Ein digital aufbereitetes Korpus zum Alt- und Mittelfranzösischen (9.–15. Jh.) steht mit der von Christiane Marchello-Nizia begründeten Base de Français Médiéval (BMF) zur Verfügung, die am ENS in Lyon gehosted wird. Das aktuell von Achim Stein und Pierre Kunstmann an der Universität Stuttgart betriebene Nouveau Corpus d’Amsterdam (NCA) stellt im XML-Format aufbereitete Texte des Altfranzösischen vom Anfang des 11. bis Ende des 14. Jh. zur Verfügung.6 Bei beiden Datenbanken bedarf es zur Nutzung einer Registrierung. Eine Recherche zur älteren Sprachstufe des Französischen bzw. seiner Entwicklung ist auch über die Datenbank von FRANTEXT (ATILF/ CNRS/Université de Lorraine) möglich, die prinzipiell Schriftzeugnisse vom 10.–21. Jh. enthält und verschiedene ergänzende Teildatenbanken umfasst (Frantext Moyen Français, Frantext AFNOR, Frantext CTLF). Während die allgemeine Version (Frantext intégral) 79 Texte zum Altfranzösischen und 279 zum Mittelfranzösischen enthält, beinhaltet die Spezialdatenbank des Frantext MF allein 219 Texte zum Mittelfranzösischen (1330–1550).
Noch im Entstehen ist das deutsch-französische Projekt einer Datenbank zu lateinischen und frühen französischen Texten (PaLaFra), geleitet u.a. von Maria Selig in Regensburg. An der LMU München wird von Thomas Krefeld und Stephan Lücke das alternative geolinguistische Projekt VerbaAlpina betrieben, welches jenseits von Nationalgrenzen operierend auch die Varietäten des französisch- und okzitanischsprachigen Alpenraumes abdeckt.
An elektronischen Editionen der ältesten französischen Texte arbeitet Martin Gleßgen in seinen Projekten an der Universität Zürich (z.B. DocLing, Gleßgen 2015), während Maria Lieber italienische und französische Manuskripte der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden (SLUB) zu erschließen sucht.
Korpora zur jüngeren Sprachgeschichte des Französischen wären beispielsweise das in vorliegendem Sammelband präsentierte Korpus CHSF zum Substandard zwischen 1789 und 1918 von Harald Thun (Kiel) oder das zur Grammaire Générale (CGEC) von Jürgen Trabant an der FU Berlin.
Читать дальше