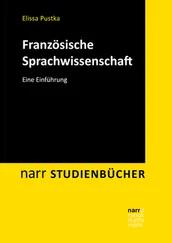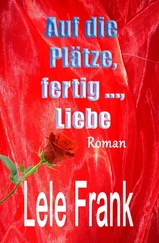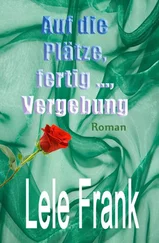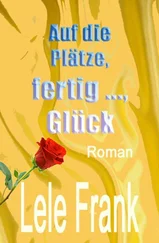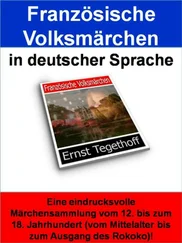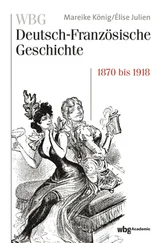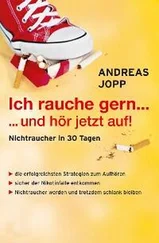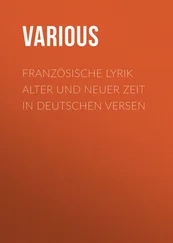In seinem Beitrag zu französisch inspirierten Ortsnamen in Deutschland eröffnet Nelson Puccio ein besonderes Panorama des Sprach- und Kulturkontaktes zwischen beiden Nachbarländern. Die erstmalige Systematisierung makro- und mikrotoponomastischer Gallizismen (u.a. Siedlungsnamen, Schlossnamen, Straßennamen, Hotelnamen, u.a.) nach Bildungsmuster und spezifischer Entlehnungssituation in direktem Sprachkontakt oder durch allgemeinen Kulturkontakt zeigt eine vielschichtige Durchdringung im Bereich der Namensgebung und die damit verbundenen Konnotationen auf.
Die im deutschsprachigen Raum früher omnipräsente französische Sprache und Kultur ist auch Thema des Beitrages von Barbara Schäfer-Prieß, die sich den sprachpuristischen Ausführungen des „Turnvaters Jahn“ widmet. In einer Analyse zum Verhältnis von Nationalismus und Sprachpurismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts werden beispielhaft die beiden Schriften Deutsches Volksthum (1810) und Merke zum deutschen Volksthum (1833) von Friedrich Ludwig Jahn untersucht, dessen als Sprachpatriotismus zu kategorisierende Einstellung auf einer Idealvorstellung der unvermischten Nationen und Völker und dementsprechend auch Sprachen beruht. Seine Abneigung richtet sich dabei nicht unbedingt rein gegen die im Deutschen jener Zeit reichlich vertretenen Gallizismen, sondern allgemein gegen Sprachmischung sowie elitäre Sprachverwendung. Ein Ausblick zeigt, wie sich der Sprachpurismus im Verlauf des 19. Jh. in verschiedenen Facetten noch steigert und dann im 20. Jh. nach einer Phase relativer Toleranz im Nationalsozialismus zunächst einen neuen Höhepunkt erreicht, dann aber zugunsten einer ideologischen Internationalisierung und einer Abwendung von dem alten Konzept der Einheit von Sprache und Nation wieder zurückgefahren wird.
Frank Paulikat unterzieht den Text der in der Abtei Benediktbeuern von Andreas Schmeller entdeckten 1803 und 1847 erstmals editierten, berühmten Dichtung der Carmina Burana einer eingehenden Analyse bezüglich der dort vorkommenden romanischen Elemente. Der Codex Buranus (CB), so wie er uns überliefert ist (Bayerische Staatsbibliothek, clm 4660), entstand wahrscheinlich in Südtirol um 1230 und weist nach heutiger Erkenntnis zwei Schreiber auf (h1, h2). Inhaltliche Anspielungen und sprachliche Eigenheiten weisen auf ein nicht erhaltenes französisches Original hin. Die Analyse der Passagen CB 95, CB 204, CB 218 und vor allem CB 118 zeigt, dass der Schreiber h2 wahrscheinlich aus dem norditalienischen Sprachraum stammte und bei der Abschrift derfranzösischen und okzitanischen Stellen der ursprünglichen Fassung seine Muttersprache mit einfließen ließ, was die italienischen Elemente erklärt.
Einen Beitrag zum Französischen am bayerischen Hof liefert Matthias Schöffel, der Bittschriften an die Gattin von Herzog Maximilian II. untersucht. Es sind Schreiben von Untertanen niedriger sozialer Schichten an Therese Kunigunde (1676–1730), in denen um eine Anstellung bei Hofe oder um finanzielle Unterstützung nachgesucht wurde. Die aus Polen stammende zweite Frau des bayerischen Kurfürsten sprach wie zu jener Zeit üblich Französisch und lernte das Deutsche nie wirklich, was die Untertanen wohl dazu nötigte, ihr Anliegen in der lingua franca des europäischen Adels vorzutragen. Die orthographische und syntaktische Analyse einiger dieser Bittbriefe zeitigt gängige semicolti -Phänomene, da die Verfasser das Französische wohl hauptsächlich mündlich erworben bzw. zumindest praktiziert hatten. Das Spektrum der unterschiedlich ausgeprägten Schreibkompetenz ist dabei erheblich und liefert ein lebendiges Bild von den Französischkenntnissen außerhalb Frankreichs jenseits der Oberschicht.
Dem Sprach- und Kulturkontakt zwischen Bayern und Frankreich widmet sich auch die Untersuchung von Matthias Waldinger, der einen Versuch unternimmt, die Gallizismen im Bairischen daraufhin zu prüfen, ob sie nur in dieser Varietät vorkommen oder auch in anderen Dialekten des Deutschen bzw. in der Hochsprache. Der größte Teil der im Bairischen vorhandenen Entlehnungen aus dem Französischen geht auf die sogenannte Alamode-Epoche zurück, als der Einfluss des Französischen am stärksten war. Sie „sickerten“ wohl meist als Lehnwörter über die deutsche Standardsprache, vor allem die Schriftsprache, im Sinne eines indirekten Kulturkontaktes ins Bairische, aber auch Entlehnungen über Nachbardialekte oder durch direkten Sprachkontakt von einzelnen Migranten bzw. Migrantengruppen (z.B. Savoyards ) können prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Dementsprechend zeigt die Analyse, dass die allerwenigsten der bairischen Gallizismen letztlich plausibel als „spezifisch bairisch“ charakterisiert werden können; allerdings fehlt hierzu wie auch zu anderen deutschen Dialekten noch eine umfassende Dokumentation über Vorkommen und Entlehnungswege.
Um Gallizismen geht es auch im folgenden Beitrag von Aurelia Merlan, die den Einfluss des Französischen auf das Rumänische des 19. Jh. untersucht. Anhand der Komödien dreier Dichter, Costache Facca (ca. 1801–1845), Vasile Alecsandri (1821–1890) und Ion Luca Caragiale (1852–1912), verdeutlicht sie die unterschiedliche Intensität der rumänischen Frankophilie (bis hin zur Frankomanie), die bereits im 18. Jh. begann (Moldau, Walachei) und nicht unerhebliche Auswirkungen auf die rumänische Gesellschaft hatte. Man kann diesen französischen Kultureinfluss in drei Etappen unterteilen: 1780–1830, 1830–1863/66 und nach 1863/66. Die dem Realismus zuzuordnenden Komödien eignen sich deshalb besonders gut als Untersuchungsgegenstand, weil sie als ein Spiegelbild der Art der Verbreitung der Gallizismen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und Regionen fungieren. Die Studie liefert zudem ein wichtiges Inventar an literarisch belegten Lehnwörtern.
Im letzten Beitrag wird der Einfluss des Französischen in Bezug auf eine ganz andere Sprachkontaktsituation und deren lexikographischen Aufarbeitung beleuchtet. Inmaculada García Jiménez setzt sich mit der Kritik an dem Diccionario de galicismos (1855) des Venezolaners Rafael Maria Baralt auseinander, die vor allem seitens des venezolanischen Universalgelehrten und Grammatikers Andrés Bello und des französischen Philologen Henri Peseux-Richard laut wurde. Ein weiterer Aspekt des Beitrages gilt den von Baralt kritisierten traductores zarramplines , die für zahlreiche französische barbarismos in der spanischen Sprache verantwortlich seien. Wer sich hinter den von Baralt nicht genannten „unfähigen“ Übersetzern verbirgt, war bisher nicht bekannt, doch vorliegende Untersuchung zeigt, dass zumindest zwei von ihnen mit einer gewisser Plausibilität ausgemacht werden können, nämlich Antonio de Capmany und José de Covarrubias.
Ergänzend zu den hier von den Herausgebern gelieferten Kurzvorstellungen der einzelnen Beiträge des Sammelbandes sei auch auf die von den jeweiligen Autoren selbst verfassten abstracts auf Französisch verwiesen, die den auf Deutsch verfassten Artikeln vorangestellt sind.
Aktueller Forschungsstand zur französischen Sprachgeschichte: Ein selektiver Überblick
Roger Schöntag
Eine Übersicht über alle Facetten der französischen Sprachgeschichte, die in der Forschung bisher oder in den letzten Jahren behandelt wurden, zu liefern – und die zudem den Anspruch auch nur einer gewissen Vollständigkeit reklamieren würde – wäre ein Unterfangen, das an dieser Stelle nicht geleistet werden kann und auch nicht soll. Dennoch erscheint es sinnvoll, einleitend zu vorliegendem Sammelband zumindest eine Auswahl rezenter Publikationen und Forschungsprojekte vorzustellen (ab den 2000er Jahren), um einerseits einen Einstieg in die einzelnen Aspekte aktueller wissenschaftlicher Beschäftigung mit dem Sujet zu ermöglichen und andererseits, um die vorliegende Publikation in der derzeitigen Forschungslandschaft zu verorten.1
Читать дальше