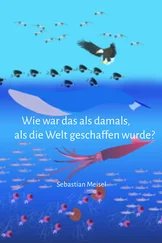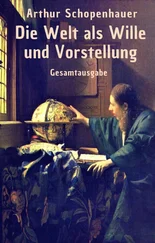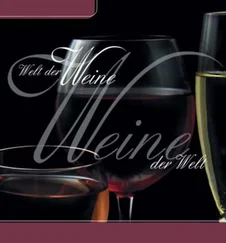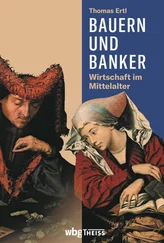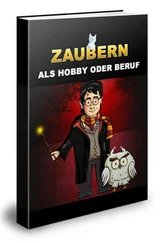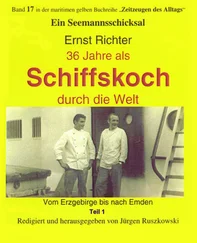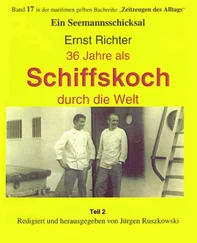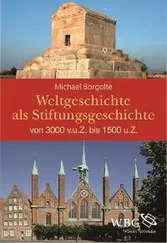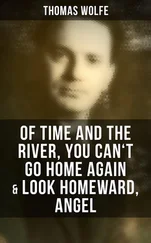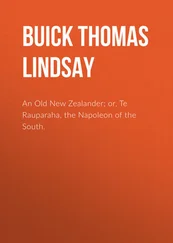Dass der Bezug des Proposal über eine bilaterale Konstellation hinausgeht, zeigt sich auch an anderer Stelle im Text, die sich zweier Figuren der GanzheitGanzheit (FdG) bedient. So nimmt der Text als Adressat seines Vorschlags nicht etwa nur die lokale Öffentlichkeit an, sondern richtet sich an nichts weniger als „die Welt“:
I CAN think of no one Objection, that will possibly be raised against this Proposal; unless it should be urged, that the Number of People will be thereby much lessened in the Kingdom. This I freely own; and it was indeed one principal Design in offering it to the World. I desire the Reader will observe, that I calculate my Remedy for this one individual Kingdom of IRELAND, and for no other that ever was, is, or, I think, ever can be upon Earth. (237)
Die FdG ‚ world ‘ steht hier ein für das Publikum, das das Proposal lesen soll. Als Text eines spezifisch ‚irischen-englischen‘ Genres richtet er sich so mit dem Adressaten „Welt“ an ein ausgesprochen großes Publikum. Doch trägt diese Hyperbel nicht nur zum allgemein-ironischen Ton der Passage (und des gesamten Textes) bei. Denn die FdG ‚ world ‘ kann darüber hinaus auch als Verweis auf den deutlich größeren, kolonialen Zusammenhang verstanden werden. Wenn die FdG ‚ world ‘ hier also nicht auf die Bedeutung eines ‚zu großen‘ Publikums reduziert, sondern als Bezugnahme auf GanzheitGanzheit ernst genommen wird, so tritt die Öffnung des Textes auf eine größere Ganzheit hin, die der Kannibalen-Topos bewirkt und vorbereitet, noch einmal deutlicher hervor. Das Proposal beschreibt eine interkontinentale Konstellation und richtet sich somit an die koloniale Ganzheit seiner Zeit.
Die hyperbolische Formulierung einer allumfassenden Zeitlichkeit, die im Passus durch den Satzteil „ever was, is, or I think, ever can be“ evoziert wird, sowie der explizit aufgerufene Raum der gesamten „Earth“ verweist ebenfalls auf eine denkbar große (zeitliche und räumliche) Extension. Dieser Bezug auf GanzheitGanzheit lässt deutlich werden, dass der Sonderstatus Irlands, den der Text auf den ersten Blick behauptet, nicht ernsthaft behauptet werden soll; IrlandIrland (im kolonialen Kontext) ist mitnichten die einzige Kolonie Englands. Das „I think“ betont zusätzlich die Ironie des Gesagten und untergräbt so den vermeintlichen Einzelstatus Irlands noch weiter.
Was sich hier erkennen lässt, ist ein Verfahren des Textes, koloniale Ausbeutungsverhältnisse körperlich grausam in Szene zu setzen und diese ‚Szenen‘ dann in ein enges Verhältnis zu FdG zu setzen. Ausgehend von diesen Beobachtungen zum Proposal soll im Folgenden für Gulliver’s Travels die folgende Struktur beschrieben werden: das Herausheben lokaler oder vermeintlich bilateraler Ereignisse in einen größeren Kontext über das Mittel des Bezuges auf literarisch inszenierte Körper – ein Verfahren, das enggeführt wird mit einer intensiven Reflektion auf größere Zusammenhänge, evoziert durch FdG.
2.2 Hinführung: Ganzheit in den vier Teilen der Travels
In allen vier Büchern der Travels 1 lässt sich ein konstanter Bezug auf GanzheitGanzheit nachweisen. Wie bereits beschrieben wurde, lässt sich dabei eine Struktur im Text isolieren, in der wiederholt scheinbar kleinteilig-lokales, über die Verschränkung der Inszenierung von Körpern mit der Arbeit an FdG, in ein Verhältnis mit größeren Ganzheiten gesetzt wird. So arbeitet der Text aktiv an verschiedenen Vorstellungen von Ganzheit.
Die im Text inszenierte/n GanzheitGanzheit/en erscheint/erscheinen dabei im Spannungsfeld zwischen Ein s heitEinsheit (Unicity) einerseits und AsymmetrieAsymmetrie (des Welt-Systems) andererseits. Der Aspekt der Asymmetrie umfasst dabei vor allem koloniale Zusammenhänge im Allgemeinen und den atlantischen SklavenhandelSklavenhandel im Besonderen.2 Der Aspekt der Ein s heit tritt im Text weniger prominent hervor und ist in der Regel an die Darstellung kolonialer Zusammenhänge gekoppelt.
Neben der beschriebenen Struktur ist die Parodie von ReiseliteraturReiseliteratur das Hauptmittel des Textes zur Arbeit an GanzheitGanzheit.3 Diese Genre-Parodie äußert sich vor allem in der Thematisierung von KartografieKartografie (und das umfasst ihr Wissen, ihre Medien und Techniken)4 sowie der Beschreibung von Menschen und/oder Wesen (‚Anderen‘), die auf den Reisen angetroffen werden. Beide Themenkomplexe sind ein fester Bestandteil der Reiseliteratur dieser Zeit und werden von den Travels intertextuell aufgegriffen. Innerhalb dieser Parodie, welche sich als durchgängige Makrostruktur des Textes beschreiben lässt, kann wiederum der Topos der Verschränkung inszenierter Körper mit der Arbeit an FdG isoliert werden; der hier vorgestellte Topos ist der Parodie von Reiseliteratur also strukturell untergeordnet. So soll das Wissen, das aus Untersuchungen zum Verhältnis zwischen dem Genre der Reiseliteratur und den Travels bereits vorliegt, um einen entscheidenden Aspekt erweitert werden, insofern deutlich gemacht werden soll, dass sich die Travels nicht nur um die Darstellung ferner Regionen der Erde und deren Bewohner drehen, sondern auch um die Frage, wie die Ganzheit, in der all diese Elemente enthalten sind, zu denken ist.
Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis der Travels zeigt einen vierteiligen Text, wobei die ersten beiden Teile jeweils acht Kapitel umfassen. Auch die Textmenge der ersten beiden Teile ist ähnlich. Die Teile III und IV dagegen umfassen einmal elf und einmal zwölf Kapitel. Auf die ersten beiden kürzeren Teile der Travels folgen also zwei längere Teile. Äußerlich betrachtet handelt es sich um einen streng strukturierten Text.
Fragt man hingegen nach der inhaltlichen Kontinuität zwischen den Textteilen, so ist der Befund weniger eindeutig. Hier wurde gehäuft darauf hingewiesen, dass die Teile I und II eine starke inhaltliche Kohärenz aufweisen, insofern die dort dargestellte Vergrößerung und Verkleinerung der dargestellten ‚Nationen‘ als Inversionen voneinander erscheinen, wohingegen der dritte und vierte Teil sich weder in Bezug aufeinander noch in Relation zu den Teilen I und II in ähnlicher Weise beschreiben lassen.5 Aus dieser Perspektive gesehen, scheint zwischen den Teilen I und II einerseits und III und IV andererseits ein ‚Bruch‘ zu stehen.6 Wie mit Blick auf aktuellere Forschungen jedoch gesagt werden kann, ergibt sich die Beschreibung eines Bruchs in der Mitte der Travels aus der Überbetonung der oberflächlichen Homogenität der Teile I und II. Denn inzwischen haben einige Studien nachgewiesen, dass sich bestimmte Themen und/oder Topoi durch den gesamten Text der Travels ziehen und ihm so eine starke inhaltliche Kontinuität geben. Exemplarisch kann etwa auf Isabel Karremanns Männlichkeit und Körper hingewiesen werden, welches jedem der vier Teile der Travels das Abhandeln jeweils eines Elements des ‚Männlichkeitskatalogs‘ des 18. Jahrhunderts nachweist.7 Auch Dennis Todds Arbeit kann hier genannt werden, der einen engen Zusammenhang zwischen dem munteren Straßenleben Londons und den im Text inszenierten Reisen herstellt, insofern beide ähnliche Attraktionen zu bieten haben: Miniaturen, Riesen, Zwerge, intelligente Pferde etc. Studien wie diese bieten also ebenso plausible wie starke Deutungen des gesamten Textes an.
Auch Jenny Mezciems bietet eine Beschreibung des ganzen Textes an:
Thematically, Gulliver’s Travels is an attack on human pride, a satire on civilized society, […] human nature as Swift saw it, and an analysis of the quality of human reason. Thematically the four Voyages are perfectly consistent: there is no individual Voyage from which any of these themes is absent, nor is the treatment of them noticeably uneven in emphasis. The themes are constant and the variations do not stray from the expression of a consistent meaning through narrative detail. In this respect the Voyage to Laputa has no less a part to play in the whole than any other Voyage. (Mezciems, „Unity“ 3)
Читать дальше